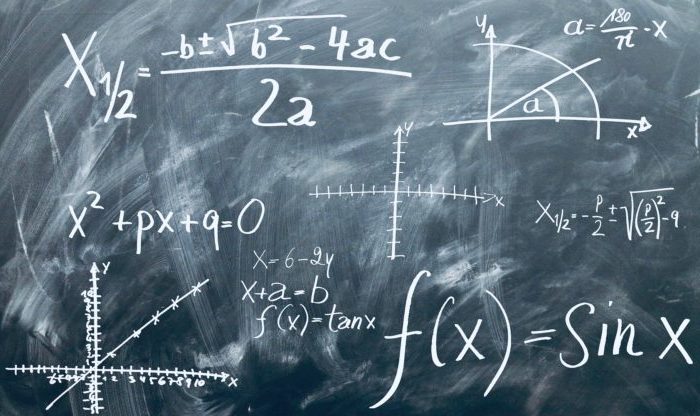Der vermessene Mensch. Eine Kritik der numerischen Unvernunft

Es darf nicht nur zählen, was gezählt werden kann. Lasst uns mehr über Gebrauchswerte reden, nicht nur über Tauschwerte oder Ableitungen davon. Das bessere Leben ist eine Frage der Qualität, nicht nur der Quantität.
Der Kapitalismus macht aus der Frage, was einer »verdient«, eine existenzielle. Jedenfalls für die meisten, deren Lebensglück als abhängig Beschäftigte daran hängt, wie hoch ihr Einkommen ist. Um dieses kreist auch jede Debatte um die »soziale Frage«. Als Problem wird dann meist in den Vordergrund gestellt, dass die einen viel mehr und die anderen zum guten Leben zu wenig »verdienen«.
Was da mit allem Recht kritisiert wird, wird meist in Zahlen ausgedrückt. Als Abstand zwischen oben und unten. Als Parameter der Leistung. Als numerische Wertschätzung. Als Datenpunkt. Als Geldbetrag. Und hier geht in Wahrheit schon das Problem los.
Selbst in vielen kritischen Perspektiven auf den Kapitalismus, auf das Auseinanderfallen von gesellschaftlicher Reichtumsproduktion und privater Aneignung, auf soziale Hierarchien und die daraus resultierenden Widersprüche »zählt« in der Regel nur, was auch gezählt werden kann. Können, Einkommen, »Wert«, Vertrauenswürdigkeit, Nutzen, Glück – praktisch alle Qualitäten werden heute in Zahlen ausgedrückt; eine Welt der Scores, eine der numerischen Unvernunft.
In dieser »Herrschaft der Zählbarkeit« liegt ein doppeltes Problem. Sie macht aus uns in zweifacher Hinsicht »vermessene Wesen«. Einerseits, weil wir glauben oder dazu gebracht werden, ständig in Daten ausdrückbare Parameter erreichen oder vermeiden zu müssen. Das verwandelt das Leben in eine dauerhafte Konkurrenzveranstaltung, in der andere besser oder schlechter dastehen. Je mehr gezählt werden kann – vom Fitnessindex über die Anzahl der Internet-Follower und das Gehalt bis zur Leistungsstärke irgendwelcher Geräte, die man »sich leisten« kann oder eben nicht, vom in Scores ausgedrückten Wert, den Menschen für Märkte haben oder eben nicht –, umso mehr gräbt sich eine Effizienz- und Leistungsorientierung in unser Denken ein. Die Konkurrenzlogik wird zu einer des Daseins.
Hier geht die zweite Seite des »Vermessenseins« los, sofern man darin die Überschreitung der Grenzen angemessenen Tuns verstehen kann. In den bestehenden Verhältnissen wäre es nämlich sinnvoll, das gesellschaftliche Interesse durch kollektive Praxis zur Geltung zu bringen, um seine Verwirklichung zu ringen. Solidarität der Vielen gegen die Aneignung der Wenigen. In den vergangenen Jahrzehnten hat die »Herrschaft der Zählbarkeit« auch dazu beigetragen, dieses Denken zu untergraben. Die Einzelnen sind heute mehr und mehr »sozialstatische Solitäre«, wie es der Soziologe Steffen Mau nennt: Solidarisches Handeln etwa als Teil einer Klasse wird vom Wettbewerb der Individuen untereinander verdrängt.
»Werde besser!« ist dabei Parole und Drohung zugleich. Man wird es allerdings nicht bei der Kritik an der Ratgeber- und Seminargesellschaft belassen können. Zwar zeigt sich hier die repressive Akzeptanz der Zahlenherrschaft und der Selbstoptimierung im Konsum – die Leute kaufen so etwas zwar nicht aus freien Stücken, aber doch immer noch selbst. Die Omnipräsenz des »Höher, schneller, weiter« resultiert aber aus Bedingungen, die dem vorausgehen: einer ökonomischen Individualisierung.
Abhängig Beschäftigte sind nicht zuletzt durch den politisch befeuerten Trend Richtung irreguläre, prekäre Arbeitsverhältnisse zu EinzelkämpferInnen geworden. Kollektive Erfahrungen in der Lohnarbeit werden auch aus anderen Gründen seltener, entsprechend verändert sich die politische Sicht. »Der Einzelne wird für sein ökonomisches Schicksal vollständig verantwortlich gemacht, das er tatsächlich aber, wenn überhaupt, nur in engen Grenzen selbst bestimmen kann«, so hat das Georg Spoo einmal formuliert. Das ebnet das Feld für eine Moralisierung der Ökonomie, die eigene soziale Lage wird ideologisch individualisiert – man ist dann zu faul, zu wenig kreativ oder gar »glücklos«.
Auch hier macht sich die numerische Unvernunft bemerkbar. Denn noch die verdrehteste Sicht auf die eigene Existenz und ihre Gesellschaftlichkeit operiert mit Zahlen, mit Vergleichbarkeit, mit Daten. Die Alternative zum »vermessenen Menschen« wäre, ihn als Inhaber unveräußerlicher Rechte zu sehen – und man müsste dann die Frage stellen, wie weit die Logik des Ökonomischen zurückgedrängt, eingehegt, verändert werden müsste, damit diese Rechte zur Geltung kommen können. Das würde auch heißen, sich etwa bei der Kritik der »Abstiegsgesellschaft« klarzumachen, dass schon in diesem Bild ein Denken fortbesteht, das die »Herrschaft der Zählbarkeit« reproduziert. Das »gute Andere«, der Aufstieg, wird als Klettern auf Leitern vorgestellt, jede Stufe eine Nummer. In den Debatten um die »soziale Frage« taucht der Einzelne als Mitglied eines Einkommensdezils auf.
Aber liegen Wohl und Wehe wirklich ein paar Zahlengruppen weiter? Schon die feministische Kritik an dem, was als Arbeit wertgeschätzt wird, hat diese Frage negativ beantwortet. Was »zählt«, darf eben nicht nur das sein, was gezählt werden kann. Lasst uns mehr über Gebrauchswerte reden, nicht nur über Tauschwerte oder Ableitungen davon. Das bessere Leben ist eine Frage der Qualität, nicht nur der Quantität.
Eine Replik von Oliver Schlaudt dazu lesen Sie hier.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode