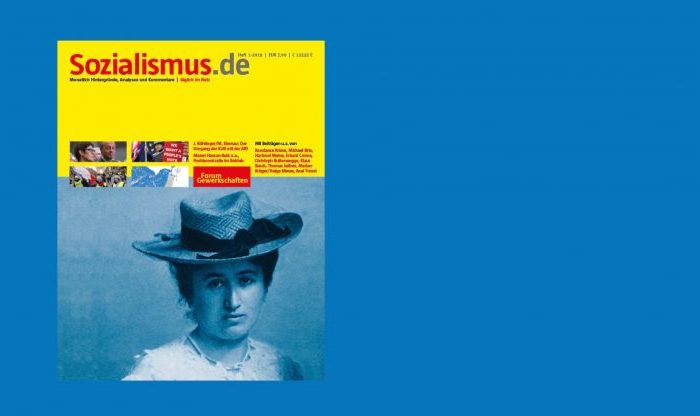»Erfurter Erklärung«, »Initiative für einen Politikwechsel« etc. – eine kleine Geschichte des Sammelns
 OXI
OXIWie kann ein Politikwechsel gelingen? Wie viel Bewegung in der Gesellschaft ist dazu nötig – und von wo kommen die Impulse? Auf welchen Forderungen gründen solche Initiativen und wen adressieren ihre Aktionen? Vor allem: Welche Erfahrungen gibt es bereits? Die jüngere Geschichte von »Sammlungsbewegungen« spielt in der aktuellen Debatte über das Projekt »Aufstehen« kaum eine Rolle. Ein Blick auf mehr oder minder ähnliche politische Gehversuche der letzten Jahre.
Nach dem ersten »Bündnis für Arbeit«
1995 hatte der damalige IG-Metall-Vorsitzende Klaus Zwickel ein so genanntes »Bündnis für Arbeit« vorgeschlagen. Seine Gewerkschaft bot an, sich 1997 mit Lohnabschlüssen in Höhe der Inflationsrate begnügen – was klar unter der üblichen tarifpolitischen Norm lag, die auch die Produktivitätsfortschritte in die Forderungen mit einbezog -, wenn Unternehmen im Jahr 1996 insgesamt 100.000 Stellen schaffen würden. Hintergrund waren die hohen Erwerbslosenzahlen und eine gesellschaftliche Debatte, in der die Bundesrepublik als »kranker Mann Europas« bezeichnet und in der Senkung von Lohnkosten das Allheilmittel gesehen wurde.
Der DGB weitete den Vorschlag, der auch unter Linken umstritten war, Ende 1995 auf alle Branchen aus. Doch auch wenn es dann zu Spitzenrunden mit der damaligen Kohl-Regierung kam, lief das Angebot der Gewerkschaften, sich Lohnzurückhaltung aufzuerlegen, ins Leere. Die schwarz-gelbe Koalition plante nun, die gesetzliche Lohnfortzahlung für Kranke auf 80 Prozent zu kürzen.
»Auf diesen Wortbruch reagierten DGB und Gewerkschaften mit einer Welle des Protestes. Im Mai 1996 wurde zusammen mit Wohlfahrtsverbänden und Kirchen ein Sozialgipfel in Köln veranstaltet«, so der Gewerkschaftsdachverband. Beim DGB lief die »Aktion Gegenwehr« an, »ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbänden« rief damals dazu auf, »den Sozialstaat zukunftssicher zu machen, statt ihn in Frage zu stellen, wenn seine Leistungen am dringendsten benötigt werden«. In Bonn gingen 350.000 bei der Demonstration »Für Arbeit und soziale Gerechtigkeit« auf die Straße. Und in Köln wurde ein »Sozialgipfel« initiiert.
Dieser »sollte Ausgangspunkt sein für eine Verständigung großer gesellschaftlicher Verbände und Institutionen über die für notwendig gehaltenen Grundlagen des Sozialstaates«. Sozial- und Wohlfahrtsverbände beteiligten sich ebenso wie die Kirchen, auch wenn diese wegen fehlender Abstimmungszeit dann nicht unter einer im Mai 1996 vorgestellten Charta standen. »An die Stelle des Beschäftigungsaufbaus tritt der Sozialabbau. An die Stelle gesellschaftlicher Kooperation tritt die politische Konfrontation«, so damals der Gewerkschafter Zwickel. »Wir halten an unserem Angebot fest. Aber wir werden den Weg zu mehr Arbeitslosigkeit und sozialem Unrecht auch entschieden bekämpfen.«
Die Erfurter Erklärung von 1997
Anfang des Jahres 1997 meldeten sich von Erfurt aus Gewerkschafter, Intellektuelle, Theologen und Politiker aus dem rot-rot-grünen Spektrum an die Öffentlichkeit. In einer Situation, in der »der soziale Konsens… durch radikale Umverteilung zugunsten der Einfluss-Reichen zerstört« werde, müssten »sich in unserem Land alle gesellschaftlichen Kräfte zusammenfinden, die bereit und imstande sind, die Verantwortung für die soziale Demokratie mit der Bindung an ein soziales Europa zu übernehmen«, hieß es in dem Appell. »Grundlegendes muß sich verändern. Und viele fragen sich: Wer soll das tun, wenn nicht wir, und wann, wenn nicht jetzt. Wir brauchen ein Bündnis für soziale Demokratie.«
Die Erfurter Erklärung wurde seinerzeit mal als vor allem von ostdeutschen Erfahrungen seit der Wende geprägte, mal als die Verbesserung der Koalitionsfähigkeit der damaligen PDS konzentrierte Aktion interpretiert. Tatsächlich lag ein Momentum des Appells darin, SPD, Grüne und Reformsozialisten zu gemeinsamer Politikfähigkeit aufzurufen. Die drei Parteien dürfen »der Verantwortung nicht ausweichen, sobald die Mehrheit für den Wechsel möglich wird«, hieß es damals. 1994 hatte die SPD im »Magdeburger Modell« eine rot-grüne Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt von der PDS tolerieren lassen, die erste rot-rote Koalition auf Landesebene startete erst 1998 in Mecklenburg-Vorpommern.
Die »Erfurter Erklärung« war unter anderem von Künstlern und Kirchenleuten unterzeichnet worden, ein Schwerpunkt lag aber auf Akteuren aus den Gewerkschaften, auch die kritischen Ökonomen Elmar Altvater (siehe hier ein Interview) und Rudolf Hickel gehörten zu den Erstunterstützern. Binnen kurzer Frist unterstützten Zehntausende den Appell mit ihrem Namen.
Zehn Jahre später sagte die Schriftstellerin Daniela Dahn, die auch zu den Initiatoren der »Erfurter Erklärung« gehörte, »an der Politik, die wir damals als Kalten Krieg gegen den Sozialstaat bezeichneten, hat sich leider nichts verändert. Im Gegenteil, sie hat sich zugespitzt, diese Richtung«.
»Aus der Zuschauerdemokratie heraustreten« 1998
Für 1998 wurde aus dem Kreis der »Erfurter Erklärung« zu bundesweiten Aktionen aufgerufen, eine zentrale Demo fand im Juni 1998 in Berlin statt. Der PDS-Politiker Wolfgang Gehrcke sagte damals, dort werde »sich zeigen, ob sich schon viele Menschen für diese andere Grundströmung in der Gesellschaft engagieren« – zu der Demo kamen Zehntausende.
»Wir streben eine demokratische, tolerante und antifaschistische Gesellschaft an. Wir verlangen Bürgerrechte für alle hier lebenden Menschen. Wir wollen eine konsequente Friedens- und Abrüstungspolitik. Wir weisen Rassismus und Ausgrenzung entschieden zurück. Eine neue Politik braucht Antrieb durch eine starke außerparlamentarische Bewegung und nicht nur Kreuzchen am Wahltag«, hieß es in dem Aufruf zu der Demonstration.
Das dahinter stehende Aktionsbündnis für eine andere Politik galt als außerparlamentarische Bewegung, allerdings hatten auch Parteipolitiker wie Jürgen Trittin, Regine Hildebrandt und Petra Pau ihren Anteil, den Aufruf zur Demonstration unterstützten fünf Gewerkschaftsvorsitzende. An der Basis bildeten sich seinerzeit örtliche Initiativgruppen, der Bezug war meist die »Erfurter Erklärung«, allerdings ging es dann auch um die Vorbereitung der Berliner Demonstration. »Sie wollen parteipolitisch nicht vereinnahmt werden, und man muß sich überhaupt hüten, die schnelle politische Mark zu machen, wenn man langfristig verläßliche Zusammenarbeit will«, so der PDS-Mann Gehrcke damals.
Der Politikwissenschaftler Johannes Agnoli sah in der Initiative zu starke parlamentarische, auf die Wahlen 1998 ausgerichtete Kräfte am Werke. »Eine ernsthafte Apo sollte auf die überflüssige Bevölkerung setzen und sich gar nicht darum kümmern, ob eine Parlamentspartei Wahlen gewinnt oder nicht. Die überflüssige Bevölkerung, das sind nicht nur einige Milliarden der Weltbevölkerung, das sind auch die Arbeitslosen im eigenen Land. Auf diese Überflüssigen müssen wir setzen, wenn wir etwas radikal verändern wollen.«
»Aufstehen für eine andere Politik«
Aus der »Erfurter Erklärung« gingen auch längerfristige Kooperationen hervor, so etwa der »Erfurter Ratschlag«, der seit 1997 als Aktionsbündnis aus Gewerkschaftern, Intellektuellen, Basisgruppen, Kircheninitiativen und Politikern wirkte. Konferenzen und Publikationen folgten, die Forderungen von 1997 hätten nach dem Regierungswechsel zu Rot-Grün »nichts von ihrer Aktualität eingebüßt«, hieß es zum Beispiel in einer Dokumentation des 3. Ratschlags, der im Januar 2000 stattfand und »ein Beitrag zur Auseinandersetzung über die aktuelle Regierungspolitik« wurde. Eine »gerechte Verteilung von Arbeit und Einkommen, ein intakter Sozialstaat, Chancengleichheit sowie zukunftsfähige Aus- und Weiterbildung«, stünden immer noch aus.
Schon 1998 erschien im Hamburger VSA Verlag ein Sammelband mit Beiträgen zur Initiative »Aufstehen für eine andere Politik«. Darin machte sich unter anderem der Gewerkschafter Horst Schmitthenner für »Eine neue BürgerInnenbewegung« stark, der Aufruf zur Berliner Demonstration vom Juni war auch abgedruckt. Einen starken Anteil machten hier auch Texte aus, die sich gegen rassistische Spaltung, ethnozentristische Sichten und internationale Solidarität einsetzten. Es ging um »Einbürgerung für alle«, Heiko Kauffmann von Pro Asyl warnte schon damals: »Erst stirbt das Recht, dann sterben die Menschen«. Einen zweiten Schwerpunkt machten sozial-ökologische Erneuerungsvorschläge aus. Beiträge kritisierten »Die faulen Zaubertricks der Neoliberalen« (die Gewerkschafterin Margret Mönig-Raane), oder den Weg in »die Dienstbotengesellschaft« (Franz-Josef Möllenberg). Ebenso heute noch sehr aktuell waren Überlegungen, Streiks und soziale Bündnisarbeit zu verbinden.
Initiative für einen Politikwechsel 2001
Für den Oktober 2001 luden dann Akteure, die man zum größten Teil schon von den zuvor geschilderten Versuchen her kannte, einen sozialen Aufbruch zu unterstützen, zu einer Konferenz nach Frankfurt am Main ein: die »Initiative für einen Politikwechsel«. Zuvor hatten Mitglieder verschiedener Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Umweltverbänden, Friedens-, Dritte Welt und kirchlichen Gruppen einen Entwurf eines Memorandums formuliert, das als »Grundlage bei der Suche nach einer gemeinsamen, sozial und ökologisch gerechten Politik-Alternative« dienen sollte.
Es ging darum, »die Vision einer gerechteren Politik« zu konkretisieren und eine Verständigung über »praktische Schritte einer weiteren Zusammenarbeit« zu erzielen. »Die Durchsetzung von Alternativen erfordert eine breite Basisbewegung, nicht für eine Partei, sondern für eine andere Politik«, hieß es damals. »Wenn eine solche Bewegung gesellschaftlich etwas verändern will, darf sie sich nicht auf den Kompromissbildungsprozess beschränken lassen, der im parlamentarischen Leben üblich ist. Sie muss überzeugende Lösungen für eine Reformstrategie präsentieren, um außerparlamentarische Artikulations- und Handlungsfähigkeit zu erlangen.«
Mitten in den Vorbereitungsprozess der Konferenz fielen die Nachrichten von den Anschlägen des 11. September. Damit traten friedenspolitische Fragen stärker in den Vordergrund, im Kern blieb das »Memorandum« aber von sozialen und ökonomischen Umbauvorstellungen geprägt: Es ging darum, Arbeit umzuverteilen und neue Arbeit zu schaffen, um Umverteilung von Einkommen und Vermögen, um einen Ökologischen Strukturwandel und den Ausbau sozialer sowie demokratischer Teilhaberechte, außerdem um die Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. »Wir wollen eine solidarische und friedliche, sozial und ökologisch ausgerichtete Zukunftsgestaltung. Wir sind das Gerede von den vermeintlichen Sachzwängen, die keine Alternativen zuließen, leid. Frieden und Sicherheit, sozial wie international, lassen sich nur durch eine neue Politik des Ausgleichs und der Gerechtigkeit herstellen«, hieß es in dem Memorandum. »Wir fordern auf, über eine solche neue, zukunftsfähige Politik zu diskutieren und dafür zu streiten.«
Schon zuvor hatte es Ansätze in dieser Richtung gegeben, im Juli 2000 war bereits eine Vorform des »Memorandums für eine andere Politik« erschienen, das unter anderem in linksgrünen Netzwerken diskutiert wurde. »Das Potenzial zum Aufbau neuer starker zivilgesellschaftlicher Strömungen, die auf gemeinsamen Interessen von Frauen, MigrantInnen, Arbeitslosen, neuen ArbeitnehmerInnen, prekär Beschäftigten und so genannten neuen Selbständigen gründen, ist durchaus vorhanden«, hieß es darin. »Die politische Kunst wird darin liegen, diese Interessen so miteinander zu verknüpfen, dass eine wahrnehmbare, attraktive plurale gesellschaftliche Strömung wider den herrschenden Zeitgeist entsteht, die Unzufriedenheit in Engagement für politische Alternativen umwandeln kann.«
Im September 2000 hatte bereits die »Halb-Zeit!-Konferenz« stattgefunden, zu der ein Trägerkreis aufgerufen hatte, der vom Aktionsbündnis »Aufstehen für eine andere Politik«, also dem Umfeld der »Erfurter Erklärung«, über Gewerkschaftsjugendverbände und Umweltgruppen bis zum Berliner Flüchtlingsrat reichte. Begonnen hatten die Planungen im November 1999, geleitet von der Frage, »wie wir unsere politischen Ziele wirkungsvoller in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einbringen können. Vielleicht ergeben sich dabei nicht nur Übereinstimmungen hinsichtlich der vorrangig zu lösenden politischen Fragen, sondern es zeigen sich möglicherweise auch Ansätze für künftige gemeinsame Aktivitäten«.
Mit Blick auf zwei Jahre Rot-Grün hieß es dann bei der Konferenz, »soziale und ökologische Ziele sind in den Hintergrund getreten, angebliche Sachzwänge regieren. Der Druck der wirtschaftlich und gesellschaftlich Mächtigen und der von ihnen geprägten veröffentlichten Meinung hat sich durchgesetzt. Ihre Mehrheitsfähigkeit versucht die rot-grüne Koalition durch Abgabenentlastungen für die ›neue Mitte‹ zu sichern. Dahinter steht die Erwartung, dass die sozial Benachteiligten sich nicht wehren werden und dass die Reformkräfte entmutigt und ohne politische Alternative resignieren werden.« Man rufe daher dazu auf, »lasst uns aktiv werden und unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam für eine andere, zukunftsfähige Politik zu kämpfen. Wir fordern insbesondere die Gewerkschaften, die Kirchen und die Sozialverbände auf, Ihren Druck in diesem Sinne zu verstärken«.
Von den Agenda-Protesten bis zur Wahlalternative
Dies stellt natürlich nur einen Ausschnitt aus den Bemühungen der letzten Jahrzehnte, so etwas wie eine übergreifende soziale Bewegung zu ermöglichen und zu unterstützen. Die jeweiligen Vorstöße hatten ihre spezifischen Bedingungen, mal war es der Widerstand gegen schwarz-gelbe Politik, mal die Hoffnung auf einen rot-grünen Regierungswechsel und später die Einsicht, dass auch das zu einem umfassenderen Politikwechsel noch längst nicht reicht.
Hinzu kommen unterschiedliche ökonomische Rahmendaten und politische Konjunkturen im progressiven Lager, die wiederum die hier beispielhaft genannten Ansätze mitprägten, etwa die seit 2002 vorübergehend starke Bewegung regionaler und lokaler Sozialforen. Mit der Ankündigung der Agenda-Reformen durch Gerhard Schröder im März 2003 kamen bundesweit Proteste gegen Hartz IV in Gang, die Gewerkschaften nahmen das Signal später auch auf und mobilisierten mit zu einer großen Demonstration mit rund 100.000 Teilnehmern im November 2003 in Berlin. Im April 2004 kamen bei mehreren Aktionen bundesweit sogar bis zu 500.000 Menschen zusammen.
Die Proteste gegen die Agenda wiederum sorgten für organisatorische Bewegung in der SPD und unter Gewerkschaftern. Auch das waren, in gewisser Weise, Sammlungsversuche. Im März 2004 traf sich zum ersten Mal die »Wahlalternative 2006« in Berlin, ebenfalls im März des Jahres wurde der Aufruf »Arbeit und soziale Gerechtigkeit« initiiert. Hier beginnt ein Teil der Geschichte der heutigen Linkspartei – aus der heraus nun für »Aufstehen« geworben wird.
Man mag Netzwerkansätze wie die Gründung des Instituts Solidarische Moderne auch zu den Bemühungen zählen, Kräfte für soziale und ökologische Perspektiven zu sammeln. Das Institut hatte sich 2010 als »Programmwerkstatt für neue linke Politikkonzepte« gegründet, die »Konzepte über Parteigrenzen hinweg im Dialog entwickeln« und »gleichzeitig eine Brücke bilden zwischen Politik und Wissenschaft, Zivilgesellschaft und sozialen Bewegungen« schlagen, also »Grenzen zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen überwinden und gemeinsam an emanzipatorischen linken Ideen für eine solidarische Gesellschaft von morgen arbeiten« will.
Willkommenskultur, Antirassismus, Flüchtlingssolidarität
Nicht zu vergessen sind die in den vergangenen zwei Jahren entstandenen Bündnis-Strukturen gegen Rassismus, für Willkommenskultur und Antifaschismus und gegen Ausgrenzung von Flüchtlingen und Migranten. Den Aufruf des lokal und regional breit aufgestellten Bündnisses »Aufstehen gegen Rassismus« unterstützen inzwischen über 28.000 Menschen. Das Bündnis plant Anfang September eine Konferenz in Frankfurter am Main. Ein weiteres Beispiel ist die »Berliner Erklärung zum Flüchtlingsschutz«, die von Initiativen aus der Zivilgesellschaft getragen wird. Bereits 2009 wurde der Aufruf www.unruhestiften.de lanciert, den bis heute über 2000 Künstler und Kulturschaffende sowie Organisationen unterzeichnet haben, und sich als »Aufruf gegen rechts, gegen die Abwälzung der Krisenfolgen und für die Umverteilung von oben nach unten, gegen die Kriegspolitik der Bundesregierung – und für die Förderung der kulturellen Vielfalt« sieht.
Der Aufruf »Welcome United« richtet sich gegen Abschiebung, Ausgrenzung und rechte Hetze sowie für gleiche Rechte für alle und hat für den 29. September in Hamburg zu einer bundesweiten Aktion aufgerufen. Die vielfältigen, regional organisierten Aktionen der Seebrücke gehören in diese Liste natürlich auch.
Und, last but not least, der Aufruf »Solidarität statt Heimat«, den aktuell weit mehr als 16.000 Menschen unterstützen, und der unter anderem den Bogen zur politischen Ökonomie der Ausgrenzung schlägt, also zu den Ursachen: »In Deutschland und Europa sind infolge der Ideologie ›ausgeglichener‹ Haushalte wichtige Ressourcen für gesellschaftliche Solidarität blockiert. Dringend notwendige öffentliche Investitionen in soziale Infrastruktur, in Bildung, Gesundheit, Pflege, sozialen Wohnungsbau und eine integrative Demokratie bleiben aus. Der deutsche Pfad von Sparpolitik und einseitiger Exportorientierung schließt viele Menschen von Wohlstand aus, schafft prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen und nährt Zukunftsängste.«
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode