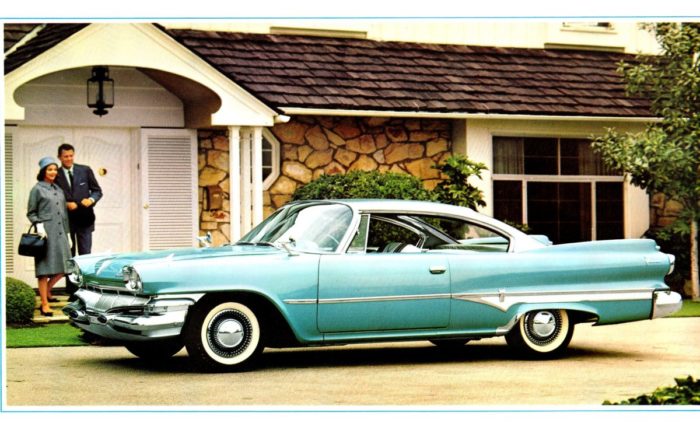Arzneimittel: Immer teurer, seltener nützlich
Die Arzneimittelausgaben in Deutschland wachsen stetig – trotz Sparbemühungen. Kosten von mehr als 50.000 Euro pro Patient sind bei neuen Medikamenten nichts Ungewöhnliches. Dabei ist längst nicht in allen Fällen belegt, dass die Innovationen auch nutzen. Trotzdem: Medikamente sollen nach dem Willen der Hersteller noch schneller auf den Markt kommen.
Stellen wir uns vor, wir könnten eine Tablette für einen Dollar herstellen und sie für tausend Dollar verkaufen. Unglaublich. Unglaublich? Genau das passiert mit dem neuen Hepatitis-C-Wirkstoff Sofosbuvir. Er ist zweifellos besser als die bisherigen Therapien, aber rechtfertigt dies derart hohe Gewinnspannen? Entwickelt wurde der Wirkstoff von Pharmasset, einem Start-up-Unternehmen, das Wissenschaftler der Emory University (Atlanta, Georgia) gegründet hatten. Als die ersten Studien an Erkrankten so erfolgreich abgeschlossen waren, dass eine Zulassung sicher schien, kaufte Gilead, ein US-amerikanisches Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen und übrigens auch das gewinnträchtigste der letzten drei Jahre weltweit, die Firma für 11,2 Milliarden US-Dollar auf.
Pharmasset hatte für Sofosbuvir einen Preis von 360 bis 600 US-Dollar pro Tablette kalkuliert – wie gesagt: bei Herstellungskosten von einem einzigen Dollar. Damit gab sich Gilead nicht zufrieden und brachte das Medikament für 1.000 Dollar pro Tablette auf den Markt. Behandlungskosten pro Patient in der Regel 84.000 US-Dollar. In den USA führt der hohe Preis dazu, dass viele Erkrankte nicht behandelt werden. Trotzdem ging die Rechnung für Gilead auf: Die Firma erzielte in den letzten drei Jahren Gewinne von deutlich über 50 Prozent auf den Gesamtumsatz.
Was kostet Forschung für neue Arzneimittel?
Die Pharmaindustrie argumentiert gerne, die hohen Preise seien gerechtfertigt, weil die Forschungskosten so hoch seien; auch wenn bekannt ist, dass sie für Marketing sehr viel mehr als für Forschung ausgibt. Dank einer Untersuchung des US-Senats, der bei Gilead Tausende Seiten vertraulicher Firmenakten einforderte, sind genaue Zahlen für Sofosbuvir bekannt: Pharmasset hatte bis zum Verkauf rund 60 Millionen US-Dollar für Forschung ausgegeben und für die letzten erforderlichen klinischen Studien für die Zulassung noch einmal die doppelte Summe projektiert. Insgesamt 180 Millionen Dollar an Studien- und Forschungskosten. Mehr nicht.
Die Industrie behauptet, ein neues Medikament zu entwickeln koste über zwei Milliarden US-Dollar. Selbst wenn Fehlschläge eingerechnet werden, kommen unabhängige Wissenschaftler (nach Abzug der Steuerersparnis für Forschungs- und Entwicklungskosten) nur auf 200 Millionen Dollar.
Was in diesen Zahlen nicht enthalten ist, das sind öffentliche Vorleistungen. Denn die Grundlagenforschung für Arzneimittel findet hauptsächlich in staatlich geförderten Labors und Universitäten statt. Nicht in den privatwirtschaftlichen Unternehmen.
Grundlagenforschung für Arzneimittel findet meist in staatlich geförderten Labors und Universitäten statt, nicht in der Privatwirtschaft.
Tweet this
Aber sind diese neuen, teuren Arzneimittel überhaupt nützlich? Die französische Fachzeitschrift Prescrire bewertet seit vielen Jahren Neueinführungen. Ihr Urteil: Rund die Hälfte der neuen Medikamente bringt keinen Zusatznutzen für die PatientInnen, nur ein Prozent bringt echte Fortschritte, fünf Prozent bieten deutliche Vorteile, 19 Prozent sind ein wenig besser. Ein Viertel schadet mehr, als es nützt, oder ist wegen fehlender Daten schlicht nicht bewertbar.
Wo bleibt der Mehrwert neuer Arzneimittel?
Ein anderes Beispiel: Das neue Brustkrebs-Medikament Palbociclib verteuert die Therapie je Patientin um 66.000 US-Dollar. Seit November 2016 ist es als Ibrance auf dem deutschen Markt. Doch ob es die Überlebenschancen erhöht, ist derzeit unklar. Die entscheidende Studie dazu wird erst Ende 2018 abgeschlossen sein. Relativ sicher ist bislang nur, dass es schlechter verträglich ist als die bisher übliche Therapie. Das Urteil des für die Bewertung neuer Arzneimittel zuständigen Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) lautete denn kürzlich auch: kein Zusatznutzen.
Fachzeitschrift Prescrire: Rund die Hälfte der neuen Medikamente bringt keinen Zusatznutzen für die PatientInnen.
Tweet this
Leider ist das kein Einzelfall. Die Forscher Chul Kim (Nationales Krebsinstitut der USA) und Vinay Prasad (Universität Oregon, Portland) werteten den Nutzen von neuen Krebsmedikamenten in den USA für einen Fünfjahreszeitraum aus. Sie stellten fest, dass bei zwei Drittel der Medikamente bei der Zulassung lediglich gezeigt wurde, dass sie das Wachstum der Tumore verlangsamen. Bei diesen 39 Medikamenten war dagegen nicht belegt, dass sie das Leben der PatientInnen verlängern. Die Industrie argumentierte, solche Vorteile würden sich später doch noch zeigen. Im Gegenteil: Vier Jahre nach der Zulassung wurde nur bei 13 Prozent der Medikamente ein Überlebensvorteil gefunden. Bei der Hälfte gibt es keinen Vorteil, bei dem Rest ist immer noch unklar, ob die Patienten von den Mitteln profitieren.
Wo bleibt der Nutzen neuer Arzneimittel?
Noch ein Beispiel: Seit zehn Jahren sind zahlreiche neue Diabetesmedikamente auf den Markt gekommen, die zweierlei gemeinsam haben. Sie senken den Blutzucker und man weiß nicht, ob das den PatientInnen wirklich nützt. Denn die europäische Zulassungsbehörde EMA (European Medicines Agency) hat sich damit zufriedengegeben, dass sich der Laborwert verbessert. Ob das aber die befürchteten Risiken von Diabetes, wie Herz-Kreislauferkrankungen oder Amputationen, verringert, bleibt unklar.
Dabei mahnt das folgende Beispiel, sich eben nicht allein auf Laborwerte zu verlassen: Im Jahr 2000 ließ die EMA den Wirkstoff Rosiglitazon zu, der den Blutzucker gut senkte. Allerdings gab es schon damals den Verdacht, dass das Medikament herzschädlich sein könnte. Erst nach elf Jahren verschwand das Mittel vom Markt. Es hatte bis 2007 allein in den USA 84.000 zusätzliche Herzinfarkte verursacht.
Schneller, höher, weiter?
Obwohl PatientInnen bereits heute also nur unzureichend vor teuren Arzneimitteln mit fraglichem Nutzen und unklarem Risikoprofil geschützt sind, versucht die europäische Behörde EMA unter dem Stichwort »adaptive Pfade« die Kriterien für die Zulassung noch vager zu fassen und damit abzusenken. Das Projekt wurde von einer Pharma-Denkfabrik, der New Drug Development ParadIGmS (NEWDIGS), von der Industrie fürstlich gesponsert, unter zentraler Mitwirkung des leitenden EMA-Mitarbeiters Hans-Georg Eichler ausgedacht. Im Kern geht es darum, die bislang notwendigen klinischen Studien zum Beleg der Wirksamkeit und Sicherheit eines neuen Medikaments (Phase-3-Studien) weitgehend abzuschaffen. Weitere Erkenntnisse sollen erst nach der Zulassung in der praktischen Anwendung gewonnen werden.
EMA versucht unter dem Stichwort adaptive Pfade die Kriterien für Arzneimittelzulassung noch vager zu fassen und damit abzusenken.
Tweet this
Der scheidende Chef der US-Zulassungsbehörde FDA warnte Ende 2016 ausdrücklich vor dem Verzicht auf Phase-3-Studien. Seine Mitarbeiter dokumentierten exemplarisch 22 Fälle, bei denen die ersten Studien an Kranken (Phase 2) erfolgreich waren, aber die FDA keine Zulassung erteilte, weil die Phase 3 zeigte, dass die Mittel unwirksam oder gefährlich oder beides waren.
Der Vorschlag der EMA schlägt also solche Warnungen in den Wind und widerspricht grundsätzlich guten wissenschaftlichen Standards. Denn Anwendungsstudien im normalen Behandlungsalltag gelten als viel weniger zuverlässig als kontrollierte klinische Studien, wobei PatientInnen nach dem Zufallsprinzip die neue oder die alte Behandlung erhalten. Das verhindert Beeinflussungen durch ungleiche Zuteilung und subjektive Einschätzungen der behandelnden Ärzte. Würden also die sogenannten adaptiven Pfade durchgesetzt, wäre das ein schlecht kontrollierter Großversuch an PatientInnen zu Lasten der Krankenkasse; denn die müsste ein vergleichsweise teures Medikament in großem Stil bezahlen, von dem sich eventuell erst nach und nach erweisen würde, dass es nichts taugt. Nach der Zulassung eines Medikaments haben Hersteller außerdem wenig Anreiz, weitere Studien durchzuführen. Sie haben die Eintrittskarte für den Markt. Und ihr Marketing erledigt den Rest. Auflagen der Behörden, weitere Untersuchungen durchzuführen, werden oft nicht eingehalten. Die gegenwärtige Rechtslage macht es schwierig, die einmal erteilte Zulassung zu widerrufen. Das ist fast nur möglich, wenn die Risiken unvertretbar hoch sind.
EMA schlägt Warnungen in den Wind und widerspricht grundsätzlich guten wissenschaftlichen Standards.
Tweet this
Was muss geschehen?
Der wichtigste Schritt: Die Zulassungsbedingungen in der EU müssen verschärft werden. Wie? Ganz einfach: Für neue Medikamente muss belegt werden, dass sie wirksamer sind als die vorhandenen. Dabei muss gemessen werden, was für PatientInnen zählt: Lebt man länger? Nehmen die Krankheitssymptome ab? Steigt die Lebensqualität? Das nützt nicht nur den Kranken, so werden auch die richtigen Anreize für die Forschung gesetzt.
Auch die Bewertung des Nutzens ist in Deutschland zu verbessern: Inzwischen dürfen nur neue Mittel bewertet werden. Die Überprüfung älterer Präparate wurde auf Druck der Industrielobby im Jahr 2016 aus dem Gesetz gestrichen – das muss rückgängig gemacht werden. Und die Preise müssen stärker sinken. Warum dürfen Pharmakonzerne für ein Krebsmittel ohne Zusatznutzen über 50.000 Euro verlangen, nur weil die Vergleichstherapie auch schon viel zu teuer ist?
Andere Wege in Europa
Vorbild Norwegen
Bereits in den 1930er-Jahren führte Norwegen eine »need clause« für Arzneimittel ein. Neue Wirkstoffe wurden nur zugelassen, wenn es für sie einen medizinischen Bedarf gibt, sie also wirksamer oder besser verträglich sind. Ausnahmen gab es nur für Generika, um Wettbewerb herzustellen. In Norwegen gab es 1992 nur rund 2.200 Arzneimittel, in Deutschland über 50.000. Der Lebenserwartung der Norweger hat das nicht geschadet, sie war damals und ist heute höher als hierzulande. Erst nach dem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) musste das Land 1994 die »need clause« abschaffen, sie galt als Handelshindernis, weil andere EWR-Staaten keine solche Regel hatten. Also wäre in der EU folgende Regel möglich: Jedes Land legt fest, dass neue Medikamente nur zugelassen werden, wenn sie nachweislich besser als die vorhandenen sind. Gesundheitsgruppen und Fachleute fordern genau das.
Preisbewusstes Italien, pharmafreundliches Deutschland
Italien war nicht bereit, die hohen Preise für das Hepatitis-C-Medikament Sofosbuvir zu zahlen, und drohte per Zwangslizenz, das Mittel in einer Fabrik des Militärs zu produzieren. Hersteller Gilead lenkte ein, und gibt sich mit 8.000 Euro je Therapie zufrieden. Da ein Mengenrabatt vereinbart wurde, zahlt das Land am Ende wahrscheinlich nur 4.000 Euro pro Patient. In Deutschland kostet Sofosbuvir die Krankenkassen über 55.000 Euro pro Therapie.
Unabhängige Forschung
Die Pharmaindustrie forscht insbesondere zu Krankheiten, bei denen es zahlungskräftige Patienten gibt. Die Krankheiten der Armen der Welt, wie Tuberkulose oder Tropenkrankheiten, werden deshalb sträflich vernachlässigt. Die Industrie investiert zwar viel Geld in Forschung, holt sich dieses Investment aber über hohe Produktpreise gleich doppelt zurück. Die Zeche zahlen Versicherte und PatientInnen. Seit Jahren gibt es bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Debatte, wie die Forschung nützlicher ausgerichtet werden könnte. Es sollen alternative Modelle gefördert und die Forschungskosten vom Produktpreis entkoppelt werden. Unter der WHO entsteht zur Zeit ein internationaler Forschungsfonds, mit dessen Mitteln unabhängig zu Antibiotika geforscht werden soll.
Dieser Text erschien in der OXI-Ausgabe vom Juli 2017.
Jörg Schaaber, Soziologe und Gesundheitswissenschaftler, arbeitet seit 1981 für die BUKO-Pharma-Kampagne, die die globale Geschäftspolitik der Pharmaindustrie beobachtet. Er ist Chefredakteur des von der Kampagne herausgegebenen Pharma-Brief und Autor von Gute Pillen – Schlechte Pillen.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode