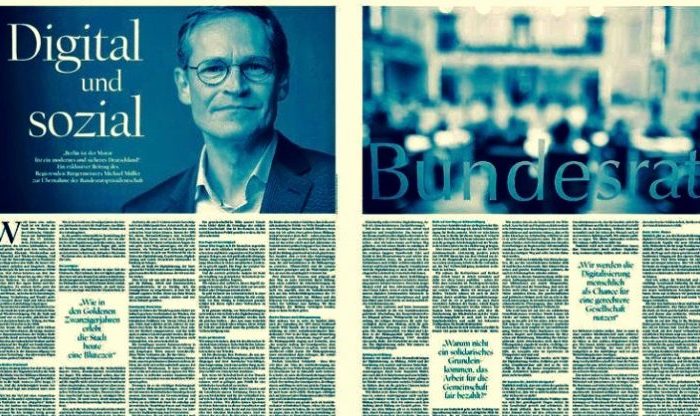Bedingungsloses Grundeinkommen? Die falsche Antwort auf richtige Fragen
 Generation Grundeinkommen / FlickrAktion für das Manifest Grundeinkommen
Generation Grundeinkommen / FlickrAktion für das Manifest GrundeinkommenDie SPD will eine Ergänzung des derzeitigen Erwerbslosenregimes als solidarisches Grundeinkommen verkaufen. Das bringt die Anhänger einer bedingungslosen Variante in Zugzwang. Die Idee spricht zwar entscheidende Probleme des Gegenwartskapitalismus an – ist aber eine trügerische Abkürzung ins Reich der Freiheit. Ein Beitrag aus dem OXI-Schwerpunkt linke Wirtschaftspolitik der Märzausgabe.
Die Debatte um das sogenannte Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) beschäftigt nicht nur die Linken schon länger. Gerade rückt sie auf der Tagesordnung der Linkspartei mal wieder ganz nach oben – Befürworter haben die Kampagne »Mit Links zum Grundeinkommen« gestartet. Damit steht das bisherige Arrangement, das im Offenlassen der Haltung der Gesamtpartei zu der Frage bestand, zur Disposition: Es soll ein Mitgliederentscheid über diese Frage herbeigeführt werden. Dazu sind noch einige Hürden zu nehmen, etwa eine ausreichende Zahl von Unterstützern aus der Mitgliedschaft. Der Vorstoß ist aber ein guter Anlass, einige allgemeinere Bemerkungen zur Debatte zu machen.
Das BGE wurde und wird immer diskutiert – auch in anderen Parteien, etwa bei Bündnisgrünen und Piraten sowie unter Sozial- und ChristdemokratInnen. Es gibt mehr oder weniger verwandte Modelle aus dem wirtschaftsliberalen Spektrum wie das »Bürgergeld« oder realisierte Spielarten des Grundeinkommens wie in Finnland. Je mehr Digitalisierung im Alltag und die sogenannte 4. Industrielle Revolution voranschreiten, fühlen UnterstützerInnen des Grundeinkommens zusätzlichen Rückenwind für ihre Forderung. Viele von ihnen argumentieren, dass ein Ende der Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kennen, nun unabweisbar auf dem Vormarsch und das BGE darauf die beste Antwort sei.
Bevor man auf die inhaltliche Seite der Debatte zu sprechen kommt, sollte man einen Blick dafür haben, wie sie sich meistens zumindest auf der politischen Linken sortiert. Man trifft dort zum einen eine Gruppe glühender BefürworterInnen des Grundeinkommens, die je nach Partei oder Organisation, je nach Landes-, Kreis- oder Ortsverband größer oder kleiner ausfällt. Auf der Gegenseite ist allerdings die Gruppe derjenigen, die fundiert und unermüdlich gegen das Grundeinkommen argumentieren, auch ziemlich überschaubar. Der Großteil der Mitglieder in Parteien, sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Verbänden verhält sich gegenüber dieser Frage eher indifferent. Dies liegt auch an der Vielfalt der Modelle für ein BGE oder weil die Unterschiede zum Konkurrenzmodell der bedarfsdeckenden Mindestsicherung nicht klar sind.
Stichhaltige Argumente dagegen
Eingangs sollen hier noch einmal die wichtigsten Argumente gegen das Grundeinkommen genannt werden, die der Autor allesamt als stichhaltig ansieht. Die landläufigste Behauptung, um ein BGE zu begründen, besteht darin, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehe. Weil die Mitglieder der Gesellschaft absehbar nicht mehr durch Erwerbsarbeit zu integrieren seien, brauche es ein Grundeinkommen. So soll eine armutsfreie Existenz auch fernab der Erwerbsarbeit möglich sein und sollen zugleich nicht erwerbsförmige, aber nichtsdestotrotz gesellschaftlich notwendige Arbeitsformen honoriert werden, denen die Menschen unvermeidlich nachgingen.
Dagegen spricht, dass bislang noch jede Prophezeiung ausgehender Arbeit (durch Mikroelektronik, Automatisierung, Internet) in ihrer schärfsten Form widerlegt wurde. Es gibt keinen Automatismus um sich greifender »Entlassungsproduktivität«. Vielmehr gibt es zahlreiche Aufgaben, in denen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen könnten, wäre die Nachfrage nach ihnen zahlungskräftig genug. Eine gleichere Einkommensverteilung und besser ausgestattete öffentliche Haushalte in Bund, Ländern und Kommunen hätten Arbeitsplatzzuwachs in den Bereichen Bildung, Erziehung, Kultur, Umweltschutz, Integration, Inklusion, Wissenschaft et cetera zur Folge. Auch würden arbeitsplatzschaffende private Investitionen eher ausgelöst, wenn die höhere Nachfrage erweiterte oder neue Kapazitäten absehbar auslasten würde.
Ein damit verwandtes Argument der BGE-BefürworterInnen betrachtet nicht die Nachfrage nach Arbeitskraft, sondern die Veränderung innerhalb der Arbeitswelt selbst. Es lautet, dass einerseits aufgrund von Prekarisierung, andererseits durch Digitalisierung das Arbeitsumfeld stärker entfremdend wirke als unter Bedingungen kapitalistischer Lohnarbeit ohnehin.
Beide Thesen sind empirisch in Frage zu stellen. Tatsächlich gibt es die Möglichkeit, dass sich die Arbeitswelt polarisiert in hochqualifizierte Beschäftigte, die einen vernetzten Maschinenpark führen auf der einen Seite und ein unterbezahltes Dienstleistungsproletariat in Logistik und Handel auf der anderen Seite. Allerdings ist hier das Problem kein rein ökonomisches, sondern ebenso sehr ein politisches.
Die Mühen der Ebene gewerkschaftlicher Solidarität
Wolfgang Fritz Haug kritisierte bereits Anfang der 1980er Jahre am Verelendungsdiskurs, dass dieser unzureichend in Widersprüchen denke und so übersehe, wie sich Beschäftigte auf allen Ebenen wichtige, systemrelevante Kompetenzen aneigneten, die von der formalen Hierarchie nicht abgebildet werden. Potenziell haben zum Beispiel auch die Beschäftigten hinterm Steuer oder der Kasse erhebliches Druckpotenzial, welches sie allerdings wegen ihrer geringeren Organisationsdichte und des höheren Organisationsaufwandes bei ihnen nicht ausschöpfen. Das Problem der notwendigen Verständigungsprozesse zwischen Beschäftigten würde aber auch das Grundeinkommen nicht lösen. Hier führt kein Weg an den Mühen der Ebene gewerkschaftlicher Solidarität vorbei.
Das Grundeinkommen würde auch nicht die drohende Zunahme der Einkommensunterschiede verhindern, die aus der genannten Auseinanderentwicklung der Arbeitswelt folgen können. Weil das BGE unterschiedslos jeder und jedem unabhängig vom Bedarf ausgezahlt bekäme und die Arbeitgeber das auch wüssten, so Claus Schäfer, der frühere Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung, würden auf ihrer Seite »die Neigung wie die Durchsetzungsmöglichkeit wachsen, dies auf die vorhandenen Löhne anzurechnen und entsprechend ihre Lohnkosten zu senken, weil das individuelle Erwerbseinkommen der Beschäftigten ja wegen des BGE unverändert bleibt«.
Auch über diesen, aus linker Sicht äußerst unerwünschten Kombilohn-Effekt hinaus kranken speziell die linken Modelle des BGE an einem unlösbaren Selbstwiderspruch. Das BGE muss eine Bedürftigkeitsprüfung ausschließen, soll aber aus direkten Steuern finanziert werden. Letzteres setzt aber eine Erfassung von Einkommen und Vermögen voraus – was man aus der linken Tasche der sozialstaatlichen Bürokratie entfernt hat, wird so unversehens über die rechte Tasche der Steuerbehörden wieder eingeführt.
Unerwünschter Kombilohn-Effekt und unlösbarer Selbstwiderspruch
Einzig das Grundeinkommen in der Vorstellung von Götz Werner entgeht diesem Dilemma. Der Drogeriemarkt-Unternehmer will alle direkten Steuern zugunsten einer einheitlichen Konsumsteuer abschaffen. Dadurch könnte man tatsächlich auf den Großteil der heutigen Steuerbürokratie verzichten, müsste aber eine größere Ungleichheit der Kaufkraft tolerieren als heute.
Doch auch dann bleibt die Abschaffung jeglicher prüfenden Sozialstaatsapparaturen illusorisch. Wie Schäfer bemerkt hat, »verschiebt ein BGE unvermeidliche Bedürftigkeitsprüfungen lediglich auf andere Ebenen. Denn selbst mit einer ›komfortablen‹ BGE-Höhe von etwa 1.000 Euro monatlich werden Bedürftigkeitsprüfungen in besonderen Lebenslagen zum Ausgleich von eingetretenen Schäden oder zur Vorbeugung bestimmter Risiken unvermeidlich sein, weil mit 1.000 Euro zwar der laufende Lebensunterhalt, nicht aber Krankheit und ihre Folgekosten, Scheidung, Unfall und anderes kompensiert werden können«.
Wenn jedoch die Notwendigkeit prüfender sozialstaatlicher Einrichtungen zugestanden wird, schrumpft der Unterschied zwischen Grundeinkommen und sanktionsfreier Mindestsicherung fast bis zur Unkenntlichkeit zusammen, und ein BGE als eigenständige Forderung erübrigt sich.
Aus Sicht einer linken politischen Ökonomie lautet der Kernvorwurf gegen das Grundeinkommen auch in seinen linken Varianten, dass sie einen uneingestandenen Liberalismus aufweisen. Damit ihre Rechnung des Grundeinkommens aufgehen kann, müssen seine UnterstützerInnen annehmen, dass die von ihnen ja als Ausgangspunkt gewählte, beobachtete ständige Steigerung des Produktionspotenzials auch immer eine entsprechende Nachfrage fände. Denn nur dann würde mit der Produktionssteigerung die Einkommensmasse erwirtschaftet werden, aus der das Grundeinkommen zu finanzieren wäre – es gilt auch hier der Mackenroth’sche Grundsatz, »dass aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden muss«.
Warum Sekundärverteilung und nicht Primärverteilung?
Eine ›Entlassungsproduktivität‹ bedeutet aber gesamtwirtschaftlich nicht nur weniger Arbeitsplätze, sondern auch sinkende Nachfrage und daraus folgende wirtschaftliche Einbrüche, wenn man nicht wie Deutschland seine Arbeitslosigkeit mit Leistungsbilanzüberschüssen ins Ausland exportiert.
Will man das nicht, müsste die Summe aus Löhnen und Grundeinkommen hoch genug ausfallen, um mit den Produktivitätsfortschritten Schritt zu halten. Das ist aber unter anderem aufgrund der genannten Problematik der Kombilohn-Effekte unwahrscheinlich. Es ist auch nicht einsichtig, warum eine ausreichend große Umverteilung der Produktivitätsgewinne durch den Staat, das heißt über die Sekundärverteilung, aussichtsreich sein sollte, wenn man sie zuvor in der Primärverteilung, das heißt über die am Arbeitsmarkt erzielten Einkommen, nicht hat durchsetzen können.
Die kritische politische Soziologie konnte schon vor Langem zeigen, dass Markteinkommen geringerem politischem Legitimationsdruck unterliegen und daher leichter durchzusetzen sind als staatliche Umverteilungen. Im einen Fall wird nur ein wirtschaftlicher Sektor in Tarifverhandlungen mit Erhöhungsforderungen konfrontiert, wobei die Höhe der Produktivitätsfortschritte und das wettbewerbliche Umfeld der Branchenbetriebe eine gewisse »Objektivität« in die Auseinandersetzungen bringen. Im anderen Fall müssen Forderungen vor der gesamten Öffentlichkeit begründet werden, womit beim Grundeinkommen ein erhebliches Dilemma auftritt, auf das wiederum Claus Schäfer hinweist.
BGE würde sich im Kern selbst ökonomisch untergraben
Das BGE müsste »gegen eine Gesellschaft und vor allem eine Politik umgesetzt werden, die faktisch wie ethisch weitgehend auf Erwerbsarbeit geeicht sind und öffentliche Ersatzleistungen bei Erwerbslosigkeit nur in Verbindung mit Bedürftigkeitsprüfung denken können. Bezeichnenderweise beleuchtet die Klage der BGE-Befürworter über die Stigmatisierung von Arbeitslosen als ›Faulenzer der Nation‹ die schon bekannte Seite des zu erwartenden öffentlichen Widerstands gegen das BGE auf der anderen Seite derselben Mentalität«.
Das Grundeinkommen dürfte also kaum geeignet sein, die Lücke zwischen Produktivitätsgewinnen und Nachfrage zu schließen, und würde sich damit im Kern selbst ökonomisch untergraben. Dass das BGE doch eine Lösung darstellt, können seine BefürworterInnen nur verteidigen, wenn sie dagegen (meistens uneingestanden) am urwirtschaftsliberalen Dogma des Say’schen Theorems festhalten, wonach das Angebot seine Nachfrage schon finde oder sich diese schaffen werde.
In einer Diskussion über das Grundeinkommen, in der ich die Position der Kritiker vertrat, sagte danach ein Zuhörer: »Alban hat wahrscheinlich recht. Und das ist sehr schade.« Er fing damit ziemlich gut die leidenschaftspolitische Schieflage solcher Debatten ein. Zwar mögen die UnterstützerInnen des Grundeinkommens die schwächeren Sachargumente auf ihrer Seite haben, an vielen Punkten angreifbar und selbstwidersprüchlich sein.
Bedürfnis der Zuhörerschaft nach emanzipatorischer Utopie
Doch ihr Angebot ist in einem entscheidenden Punkt attraktiver, weil es das Bedürfnis der Zuhörerschaft nach emanzipatorischer Utopie, nach Befreiung aus kritikwürdigen Zwängen anspricht. Die KritikerInnen des Grundeinkommens erscheinen in der Dramaturgie der Debatten beinahe unvermeidlich als SpielverderberInnen gegen eine sympathische Vision der Gesellschaftsveränderung »von unten«.
Während die BefürworterInnen des BGE Freiheit und Befreiung, die Überwindung von Repression und Stigmatisierung im Hartz-IV-System und in unwürdigen Arbeitsverhältnissen beschwören, müssen sich seine GegnerInnen einer viel ernüchternden Sprache bedienen, wenn sie von Primär- und Sekundärverteilung, vom öffentlichen Haushalt, Steuerquote, Produktivitätsniveaus, Kapazitätsauslastungen und so weiter sprechen.
Nicht nur der Inhalt, sondern auch diese ernüchternde Stimmungslage in den BGE-Diskussionen sind Kinder ihrer Zeit, in der die politische Linke an politisch-ökonomischer Kompetenz erheblich verloren hat. Mittlerweile kennt eine ganze Generation Vollbeschäftigungspolitik nur unter dem Vorzeichen, dass jede Arbeit besser ist als keine, dass der aktuelle gute Beschäftigungsstand in Deutschland über »Lohnnebenkostensenkung« durch Lohnverzicht und Sozialabbau erkauft werden musste und so weiter. Weil das Gegenrezept zum Grundeinkommen aber nun mal im Kern in einer Vollbeschäftigungspolitik besteht und die makroökonomische Sprache vielen fremd geworden ist, klingen die BGE-GegnerInnen oft trotz gegenteiliger Absicht dem Sound der Sachzwang-Rhetorik ähnlich.
Frage nach Emanzipation nicht nur in der Arbeit
Die GegnerInnen des BGE sollten deswegen neben den richtigen und wichtigen Sachargumenten immer ansprechen, warum zwar das Grundeinkommen keine Lösung bietet, es aber richtigerweise Probleme der Gegenwartsgesellschaften anspricht.
Neben der Frage nach Emanzipation nicht nur in der Arbeit durch bessere Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmung, weniger Hierarchie et cetera ist genauso unverzichtbar die Frage nach Emanzipation von der Arbeit zu stellen, die durch Arbeitszeitverkürzung und lebenslagenfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie durch eine armutsfeste sanktionsfreie Mindestsicherung sowie die Arbeitslosenversicherung zu beantworten sind.
Ebenso richtig sind die von den BGE-Befürwortern aufgeworfenen Fragen nach Tätigkeiten, die wegen mangelnder Profitabilität nicht verrichtet werden, nach kooperativen Arbeitsformen. Nicht weniger relevant sind im betrieblichen und behördlichen Alltag auch nicht direkt arbeitsbezogene Konkurrenzen um Ansehen und Verfügungsgewalt, denen zu entkommen sich manche vom Grundeinkommen versprechen.
Die Unsichtbarkeit linker Wirtschaftspolitik macht das BGE-Versprechen attraktiver
So wird, weil die verschiedenen Spielarten und Vorhaben linker Wirtschaftspolitik oft unbekannt sind, viel häufiger als diese das BGE mit dem Anspruch verbunden, den Betroffenen einen Ausweg aus dem Korsett der patriarchalischen oder despotischen Verhältnisse in Kleinfamilien, Kleinstbetrieben, aus illegalisierter Beschäftigung oder Qualifizierungsverlusten und sozialem Abstieg zu weisen.
Ohne Hinweise darauf, warum die linke Wirtschaftspolitik diese Fragen besser beantworten kann und worin ihr gesellschaftsveränderndes Potenzial liegt, kann der irrtümliche Eindruck entstehen, die BGE-GegnerInnen wollten nicht nur auf die Unvermeidlichkeit der Erwerbsarbeit für die Erzeugung von Einkommen schlechthin hinweisen, sondern auch die Unterordnungs-, Herrschafts- und Ausgrenzungsverhältnisse argumentativ verteidigen, die in der bürgerlichen Gesellschaft an diesen ökonomischen Basiszusammenhang geknüpft sind.
Es geht unter dem Strich um die Erkenntnis, dass das BGE eine trügerische Abkürzung ins Reich der Freiheit ist. Das Reich der Freiheit zu vergrößern, bleibt jedoch fortschrittliches Ziel par excellence, und über die richtigen Instrumente wird man weiterhin und richtigerweise streiten dürfen.
Linke Hoffnung, Kältestrom und Wärmestrom
Die Debatte erreicht ein umso höheres Niveau und einen umso größeren Nutzen für die fortschrittliche Bewegung, wenn beide Seiten jeweils abbilden, was Ernst Bloch in seinem »Prinzip Hoffnung« den Kälte- und Wärmestrom des Marxismus genannt hat. »Seine unerschöpfte Erwartungsfülle bescheint die revolutionäre Theorie-Praxis als Enthusiasmus, seine strengen unüberschlagbaren Determinierungen fordern kühle Analyse, vorsichtig genaue Strategie; das Letztere bezeichnet kaltes, das Erstere warmes Rot. Diese zwei Weisen Rotsein gehen gewiss stets zusammen, dennoch sind sie unterschieden.«
Anders gesagt: Ohne die »Abkühlung«, als die das Säurebad der politischen Ökonomie auf die VertreterInnen utopischer Entwürfe wirkt, »käme Jakobinertum oder gar völlig verstiegene, abstraktest-utopische Schwärmerei heraus. So wird hier dem Überholen, Überschlagen, Überfliegen Blei in die Sohlen gegossen, indem das Wirkliche erfahrungsgemäß selber einen schweren Gang hat und selten aus Flügeln besteht«.
Doch die Ergänzungsbedürftigkeit gelte auch in die andere Richtung. »Ohne solche Erwärmung der historischen wie erst der aktuell-praktischen Bedingungsanalyse unterliegt Letztere der Gefahr des Ökonomismus und des zielvergessenen Opportunismus; dieser vermeidet die Nebel der Schwärmerei nur insofern, als er in den Sumpf des Philistertums gerät, des Kompromisses und schließlich des Verrats«, so Bloch. »Zum Wärmestrom des Marxismus gehören aber die befreiende Intention und materialistisch-humane, human-materialistische Realtendenz, zu deren Ziel all diese Entzauberungen unternommen werden. Von hier der starke Rekurs auf den erniedrigten, geknechteten, verlassenen, verächtlich gemachten Menschen, von hier der Rekurs auf das Proletariat als die Umschlagstelle zur Emanzipation.«
Die linken GegnerInnen des Grundeinkommens verfügen meines Erachtens über die besseren Argumente. Sie müssen die Auseinandersetzung mitunter mit erheblichem Gegenwind führen, weil das BGE einen emanzipatorischen Impuls ohne den Ballast einer richtungspolitischen Ideologie verspricht, der vielen ZuhörerInnen nach dem Scheitern von autoritärem Staatssozialismus und bürokratischem Sozialreformismus, also den beiden wichtigsten Spielarten westlich-fordistischer Gesellschaftssteuerung überaus attraktiv erscheint.
Wenn die Grundeinkommensdebatte dazu beiträgt, dass die immer wieder zu erneuernde Ergänzung von Kälte- und Wärmestrom linker Ansprache besser als zuvor gelingt, wird sie einen wichtigen Beitrag zur Vorwärtskommen linker Ziele insgesamt geleistet haben.
Alban Werner ist 1982 in Aachen geboren und war von 1999 bis 2004 Mitglied bei der SPD. Seit 2005 ist er bei der Linkspartei auf verschiedenen Ebenen aktiv. Der Politikwissenschaftler schreibt unter anderem in »Sozialismus« und »Das Argument«.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode