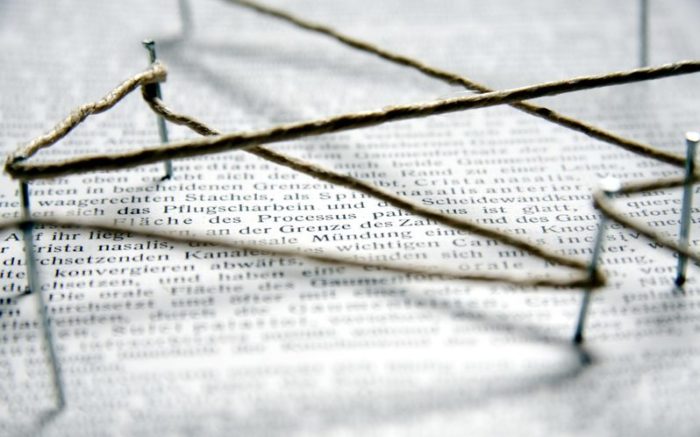»Als Marxist hat sich niemand zu erkennen gegeben«
Sie leitete ab 1988 die Hochschule für Ökonomie in Ostberlin und war in der Übergangsregierung unter Hans Modrow Wirtschaftsministerin. Ein Gespräch mit Christa Luft über Frauen in der DDR, Macht oder Ohnmacht der Wirtschaftswissenschaften – und linke Einseitigkeiten.
Frau Luft, wie war es in der DDR, wenn man als Frau Ökonomin werden wollte?
Darüber habe ich mir bislang tatsächlich nicht allzu viel Gedanken gemacht. Was dafür spricht, dass es eine große Selbstverständlichkeit hatte. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Meine Eltern hatten Tiere und für mich stand fest: Wenn es mal dazu kommt, dass du studierst, dann machst du Veterinärmedizin. Ich wusste auch schon, dass ich in das Tierseuchenforschungsinstitut der DDR auf der Insel Riems gehen werde. Nach der 11. Oberschulklasse wurde ich dann aber nach Halle delegiert, auf die Arbeiter- und Bauernfakultät, ABF. Mit verstärktem Russischunterricht.
Eine Auszeichnung, die zugleich ein Marschbefehl war.
Das war ein Problem in der DDR. Die eigenen Entscheidungsspielräume waren ziemlich begrenzt. Man konnte sich kaum aussuchen, was man wo machen möchte. Ich kam von der Oberschule aus einem sprachlichen Zug und wurde in Halle in den naturwissenschaftlichen Zweig gesteckt. Da schrieb ich meine ersten Vieren in Physik und Mathe, habe das aber rasch aufholen können. Nach nur einem Jahr Latein fehlte mir das kleine Latinum für den medizinischen Zweig, und den Stoff neben dem normalen Studienbetrieb zu bewältigen, war unmöglich. ABF war wirklich von morgens bis abends, einschließlich eines bewachten Mittagsschlafes, ein durchorganisiertes System. Ich habe dort viel gelernt, zum Beispiel auch gut Russisch.
Wie ging es weiter?
Dann kam, wie der Zufall es will, eine Delegation der neugegründeten Hochschule für Außenhandel in Berlin-Staaken. Die suchten Interessenten. Ich stand vor der Aufgabe, mir ein anderes Metier zu suchen und entschied, dass ich mich dort bewerbe. Ich hatte ja Interesse an Politik, Wirtschaft und Fremdsprachen. Das passte also. Und mich haben Außenwirtschaft, Weltwirtschaft interessiert. 1958 wurde diese Hochschule wie zuvor 1956 die Hochschule für Finanzen Potsdam-Babelsberg mit der Hochschule für Planökonomie in Berlin Karlshorst vereinigt. Es entstand die Hochschule für Ökonomie (HfÖ), die größte wirt schaftswissenschaftliche Lehr- und Forschungseinrichtung der DDR.
Waren die Lehrinhalte vielfältig oder konzentriert auf die Klassiker des Marxismus-Leninismus?
Bürgerliche Ökonomen spielten eine Rolle. So waren zum Beispiel Smith und Ricardo angesagt. Wir haben uns mit deren Auffassungen zwar kritisch auseinandergesetzt, aber sie gehörten zum Lehrprogramm. Doch es war ein großes Manko und das bedauere ich bis heute, dass wir mit bürgerlicher Literatur kaum im Original in Berührung kamen. Wir sollten uns mit den Lehren der bürgerlichen Ökonomen auseinandersetzen, bekamen die aber nur über Sekundärliteratur zur Kenntnis. Das ist natürlich kein guter Weg, wenn man eine Auseinandersetzung wünscht, zu verweigern, dass die Studenten dann auch im Original lesen können. Das hat mich von Beginn an gestört. Als ich 1988 Rektorin der Hochschule für Ökonomie wurde, war eine meiner ersten Amtshandlungen, den Zugang zu den »Giftschränken« zu erleichtern, in denen die bürgerliche, die Westliteratur lagerte. Das war spät, aber immerhin.
Das haben Sie sich getraut?
Ich habe nicht gefragt, sondern gemacht. Gerade, wenn die Außenwirtschaftler ihre Arbeiten schreiben mussten, war es doch notwendig, sich mit bürgerlicher Wirtschaftswissenschaft zu befassen. Und es war eine unerhörte Prozedur, bevor das genehmigt wurde, oder oft eben auch nicht. Ich habe kein Aufheben gemacht, sondern einfach wissen lassen: Alle haben jetzt den Zugang. Bereits Mitte der 1980er Jahre hatte ich für jährlich zehn bis 15 Studierende mit der Ökonomischen Universität Wien eine Vereinbarung über ein zunächst einsemestriges, dann zweisemestriges Zusatzstudium getroffen. Trotz einiger Hürden hat es geklappt und blieb bis zur Abwicklung der HfÖ erhalten. Der Effekt war ein doppelter. Nach Rückkehr aus Wien berichteten die Teilnehmer, auf welchen Gebieten man dort weiter ist als bei uns. Aber sie wussten nach dieser Vergleichsmöglichkeit auch, bestimmte Umstände des Studiums in der DDR besser zu schätzen.
Können Sie sich erinnern: Gab es in der Phalanx derer, die damals gelehrt wurden, eine Ökonomin?
Nein, kann ich nicht. Oder so: Wir haben natürlich auch Rosa Luxemburg gelesen, die nicht von Hause aus Ökonomin war, aber viele bis heute lesenswerte ökonomische Texte geschrieben hat. Aber so wie heute Elinor Ostrom sicher in aller Munde ist, so etwas gab es damals nicht.
Aber studiert haben schon viele Frauen?
Ja, die Hochschule für Ökonomie, die HfÖ, war bekannt dafür, dass immer sehr viele Frauen dort studiert haben. Ich würde fast sagen, fünfzig-fünfzig. Auch bei den Außenwirten.
Das war bis zum Schluss so, die gute quotierte Studentenschaft?
Ja, bis zum Schluss.
Trotzdem waren Sie mit der Karriere, die Sie dann gemacht haben, doch eher die Ausnahme in der DDR und nicht die Regel.
Also die Gründungsrektorin der HfÖ war Professor Eva Altmann, die hat Politische Ökonomie gelehrt. Vielleicht lag darin schon ein Grund, dass Frauen an der Hochschule Aufmerksamkeit genossen. Es gab Frauenförderungspläne. Gut, die gab es ja überall. Aber ich kann mich erinnern, dass eine ganze Reihe promovierter, dann habilitierter Frauen, sofern es Stellen gab, zur Professorin berufen worden sind. In der Zeit, die ich überschaue, gab es jedoch in der ganzen DDR, wenig Rektorinnen. An der TU Dresden, in Merseburg und dann eben ab 1988 mich an der Hochschule für Ökonomie.
Wir könnten also mal kühn behaupten, die universitäre Landschaft, die Forschungslandschaft ist heute weitaus stärker als in der DDR eine Männergesellschaft.
Können wir. Als ich Ende 1960 mit dem Studium fertig war – ich wollte übrigens gar nicht an der HfÖ bleiben und hatte schon einen Arbeitsvertrag mit einem Außenhandelsbetrieb –, hatte die Hochschule plötzlich sieben Assistentenstellen zu besetzten. So etwas gibt es heute gar nicht mehr. Dann wurden aus meinem Studienjahr sieben Absolventen ausgesucht und gefragt, seid ihr für den Frieden oder nicht, und kamen auf die Assistentenstellen. Sechs Männer und ich. Durchgehalten bis zur Abwicklung der HfÖ haben mit Unterbrechung durch Auslandsaufenthalte ein männlicher Kollege und ich. Es gab damals eben auch Stellen. Und in der Praxis waren viele Positionen zu besetzen. Die Zeit ist also mit der heutigen nicht vergleichbar.
Machen wir den Sprung in die Wendejahre und in das andere System. In meiner Wahrnehmung erklärten von da an nur noch Männer, wie Wirtschaft funktioniert. Sie waren eine Ausnahme als wirtschafts- und haushaltspolitische Sprecherin der PDS-Fraktion und vorherige Wirtschaftsministerin der Modrow-Regierung.
Es gibt ja den ewigen Vorwurf, die Linken können Wirtschaft nicht. Und ich muss sagen, in unserer Gruppe hat sich auch niemand um das Thema beworben. Wirtschaft und Finanzen waren »harte« Themen, Frauen haben da nicht Schlange gestanden. Das machst du, hat man einfach zu mir gesagt. Ich wusste, dass ich es von jetzt an in den anderen Fraktionen mit Abgeordneten zu tun haben werde, die alle einen neoklassischen Ausbildungshintergrund hatten: Homo oeconomicus, der Markt richtet alles, der Staat muss sich weitgehend raushalten. Es herr-schte die Ideologie der sogenannten Sachzwänge. Ich merkte aber: Mein Gott, du hast ja auch was zu bieten. Trotzdem hieß es immer: Sie haben nur Marx und Lenin im Kopf, von Marktwirtschaft verstehen Sie nichts.
Kamen Sie dagegen an?
Es ging sowieso nur, mit handfesten Argumenten und Beispielen zu punkten und sich nicht unterkriegen zu lassen. In der eigenen Fraktion habe ich manchmal, wenn ich mit Wirtschaftsthemen anfing, zu hören bekommen: Mit dem Thema kannst du auch in die CDU oder FDP gehen. Dieses »die Linken haben mit Wirtschaft nichts am Hut«, ist natürlich ein Totschlagargument, aber wir selber haben auch viel Anlass gegeben.
Ist das heute auch noch so?
Bis zur Stunde geben wir nicht wenig Grund, dass dieses Argument immer wieder aufgewärmt wird. Wirtschaft wird oft als »Sündenbabel« gesehen. Und Skandale wie Steuerhinterziehung von Konzernen, Abkassierung öffentlicher Fördergelder und anschließende Betriebsverlagerung ins Ausland, steigende Börsenkurse bei angekündigter Entlassung von Beschäftigten usw. erhärten diesen Eindruck. Aber Wirtschaft ist ein Hauptbereich der Gesellschaft, vor allem dort findet Wertschöpfung statt und das bedarf der konstruktiven Aufmerksamkeit.
Als Sie 1988 Rektorin der HfÖ wurden, haben Sie in Ihrer Antrittsrede gesagt: Ich möchte, dass dieses große Potenzial, das wir im Lehrkörper und unter den Studenten haben, nicht dazu da ist, immer im Nachhinein bejubeln zu müssen, wie weise die Parteiführung wieder Beschlüsse gefasst hat, sondern ich möchte, dass wir im Vorfeld daran mitarbeiten können.
Auf den Satz bin ich bis heute stolz. Es hätte schiefgehen können. Ich sehe, während der Saal applaudierte, die betretenen Gesichter der Ehrengäste in der ersten Reihe vor mir. Und später ist mir auch gesagt worden, dass ich so kesse Reden nicht allzu oft würde halten können.
Sind Sie denn in dieser kurzen Zeit, die noch blieb, gefragt worden, bevor die Partei ihre Beschlüsse fasste?
Ich hatte sofort Arbeitsgruppen gebildet, 14 an der Zahl, die für den zehnten Parteitag im Mai 1990 zuarbeiten sollten. Dann haben wir die Ergebnisse dieser Arbeit an ZK-Abteilungen und die Ministerien geschickt. Das höchste, was wir bekamen, war eine Eingangsbestätigung. Meist aber gar keine Reaktion. In den Zeiten davor wurde uns oft gesagt, dies und das ginge uns alles nichts an, wir sollten uns da nicht einmischen. Heute sage ich: Für die damalige Zeit war das, was wir da versucht haben, schon etwas kühn. Aber gemessen an dem, was notwendig gewesen wäre, nicht ausreichend. Wir hatten schon oft die Faust in der Tasche und haben sie nicht auf den Tisch gehauen.
Trotzdem wurde die HfÖ kritisch beäugt.
Nach der Wende hat Margot Honecker in einem Gespräch mit einem Journalisten gesagt, die Hochschule für Ökonomie sei schon immer eine revisionistische Denkfabrik gewesen. Und da habe ich gedacht: Ihr habt bis zum Schluss nichts begriffen. Als Revisionismus galt alles, was auch nur ein wenig von den orthodoxen Parteibeschlüssen abwich.
Wenn Sie sich heute anschauen, welches Rüstzeug die Universitäten und Hochschulen in den Bereichen Wirtschafts- und Finanzökonomie vermitteln, wie bewerten Sie das?
Ich bin erschüttert. Natürlich. Aber, wer dieses System für das Ende der Geschichte hält, stellt sich gar nicht die Frage, ob es notwendig ist, die eigene Sicht zu ergänzen, sich mit anderen Theorien oder Denkansätzen zu befassen. Man hat ja auch alles in die Tonne getreten, was an Erfahrungen in dem anderen Wirtschaftssystem gemacht wurde. Obwohl man daraus hätte lernen können. Dass man Ressourcen und deren Verbrauch planen muss, klingt so selbstverständlich. Wird aber nicht gemacht. Wer aber nicht in die Zukunft schauen und entsprechend planen will, fährt an den Baum.
Heute ist an den Universitäten und Hochschulen die dominierende Denkschule die Neoklassik. Die in der Politik als Neoliberalismus erscheint. Wer sich dem nicht anschließt, hat es schwer, berufen zu werden auf freiwerdende Lehrstühle. Die letzten Marxisten sind aus der Hochschullandschaft verschwunden, Keynesianer kann man mit der Lupe suchen. Wobei, die Nachfolgeeinrichtung der HfÖ und die Universität Bremen wohl zwei Einrichtungen sind, die da eine Ausnahme darstellen. Da soll es Keynesianer geben und manche von denen haben sogar einen gewissen marxistischen Einschlag.
Findet die Einteilung in Schulen weiterhin so starr und den alten Frontlinien folgend statt?
Es gibt ja den Verein für Socialpolitik, der alle deutschsprachigen Ökonominnen und Ökonomen umfasst. Und da gab es vor Jahren mal eine Umfrage, wer sich wie einsortiert. Viele haben gesagt, sie wollen sich nicht einsortieren lassen. Als Marxist hat sich niemand zu erkennen gegeben, als Keynesianer schon. Aber unter Studierenden gibt es Bewegung und auch unter jüngeren Hochschullehrern, die unzufrieden sind mit dem vorherrschenden Curriculum. Mit der theoretischen Enge. Sie vermissen Wirtschaftsgeschichte, Geschichte ökonomischer Lehrmeinungen, eben neben Hayek und Friedman auch Smith, Ricardo und Marx, Ethik, Verhaltensökonomik und vieles mehr.
Sie sind also verhalten optimistisch?
Ich glaube, da kommt Bewegung hinein, wenn auch sehr langsam. Aber die praktische Situation wird auch die Theorie drängen, bestimmte Dinge anders zu betrachten. Wenn man sich nur mal anschaut, wie der Ökonom Peter Bofinger, der im Sachverständigenrat sitzt, von den anderen vieren abgewatscht wird. Immer wieder. Nur weil er eine andere Meinung hat. Wenn man sich die eine Alibifrau anschaut, die sich dieser Rat der Weisen leistet. Die dort gut reinpasst. Es müssen sich viele Dinge ändern.
Da es in der Öffentlichkeit so wenig Ökonominnen gibt, lässt sich gegenwärtig auch schwer sagen, ob anders über Wirtschaft geredet würde, gäbe es nur mehr Frauen.
Man kann nichts generalisieren. Und wir können mangels praktischer Beweise auch nicht verallgemeinern, dass Ökonominnen andere Vorschläge unterbreiten würden, einen anderen Blick auf den Umgang mit Ressourcen, mit dem Planeten haben.
Ich finde auch die Linken sehr einseitig, wenn die sagen, man komme nur voran in der Gesellschaftsentwicklung, wenn man die Eigentumsverhältnisse umstürzt. Für die lange, lange Sicht ist das natürlich richtig. Aber warum, frage ich mich, machen wir nicht stärker Druck beim Umgang mit Grund und Boden. Diese Ressource ist nicht vermehrbar und zum Spekulationsobjekt geworden. Warum kann man nicht einen öffentlichen Bodenfonds bilden, statt immer weiter Ackerland zu privatisieren? Oder: Der Handel mit Grundnahrungsmitteln hat an der Börse nichts zu suchen. Mit Weizen, Mais, Reis usw. darf nicht spekuliert werden. Das ist pervers. Die einen scheffeln Geld damit, die anderen verhungern. Reparaturfähigkeit von technischen Konsumgütern ist ein Gewinnerthema. Es gibt so viele ganz praktische Dinge, die man heute anfassen kann und muss. Ich wünschte mir, dass wir solche Dinge viel deutlicher auf die Tagesordnung setzen und so bei Menschen Aufmerksamkeit für linke Politik erreichen.
Woher rührt Ihrer Meinung nach die Deutungshoheit, Deutungsmacht der Ökonomen?
Ich sehe es gar nicht so, dass die eine so hohe Deutungsmacht haben. Was haben wir in der Bundesrep ublik? Diesen Sachverständigen-rat. Wenn der seine dicken Papiere mit den »Sachzwängen« vorlegt, bekommt er ja auch Gegenwind. Dass die Wirtschaftsweisen komplett durchdringen mit ihren Thesen, kann ich nicht sehen.
Ich bedaure eher, dass über dieses Gremium hinaus nicht andere Denkwerkstätten offiziell und regelmäßig von der Politik wahrgenommen und richtig abgefragt werden. Ich meine zum Beispiel die Arbeitsgruppe »Alternative Wirtschaftspolitik«, die solide Analysen und Berichte vorlegt. Und oft hat sich bestätigt, was sie vorausgesagt hat. Aber deren Arbeiten werden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Das ist ein Skandal, ein selektiver Umgang mit ökonomischer Wissenschaft.
Wenn sich Leute mit hoher Expertise zusammensetzen und etwas sagen, was nicht in den Kram passt, dann werden sie totgeschwiegen. Aber die man sich einmal als Expertise rausgesucht hat, werden doch ohne Ende gehypt.
Aber das hängt doch von der Regierung ab und vom Parlament. Letzteres müsste den einseitigen Umgang mit der Wissenschaft viel mehr in den kritischen Blick nehmen.
Es werden zu wenige und dann auch noch die Falschen zur Kenntnis genommen?
Ja, und was ich beobachte in den letzten Jahren: Der wortmächtigste unter den Ökonomen war ja lange Hans Werner Sinn. Wenn solche Leute dann raus sind aus ihren bestallten Funktionen, fangen sie plötzlich an, manche alte Denkschablone abzustreifen und ein wenig zur Vernunft zu kommen.
Ich glaube eher, dass nicht die Wirtschaftswissenschaft mächtig ist, selbst bei diesen Sachverständigen. Stattdessen sind es die Lobbyisten. Wir leben doch in einem System, das durchdrungen ist von Lobbyisten. Das sind die Einflüsterer, die der Regierung schon bevor der Sachverständigenrat seine Gutachten veröffentlicht, längst gesagt haben, was sie zu tun und was sie zu lassen hat.
Was halten Sie von feministischer Ökonomie?
Ich gebe zu, dass dies nie mein Spezialgebiet war. Aber unter den vielen neuen Ansätzen, die es gibt, und manche von ihnen werden an einzelnen Hochschulen oder von einzelnen Ökonomen vermittelt, gehört feministische Ökonomie auf jeden Fall dazu. Ich habe allerdings den Eindruck, dass dies in der Breite nicht angekommen ist. Schon gar nicht in der Politik. Dieser ganze Bereich Care-Arbeit, um den die feministische Ökonomie ja auch wesentlich kreist. Da wird doch weiterhin so getan: Das ist Frauensache, das wird gemacht und mehr müssen wir dazu nicht sagen.
Christa Luft, Jahrgang 1938, ist Ökonomin und leitete ab 1988 die Hochschule für Ökonomie in Ostberlin. In der sogenannten Übergangsregierung unter Hans Modrow war sie Ende 1989, Anfang 1990 Ministerin für Wirtschaft. Von 1994 bis 2002 war Christa Luft Bundestagsabgeordnete der PDS. Das Gespräch führte Kathrin Gerlof.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode