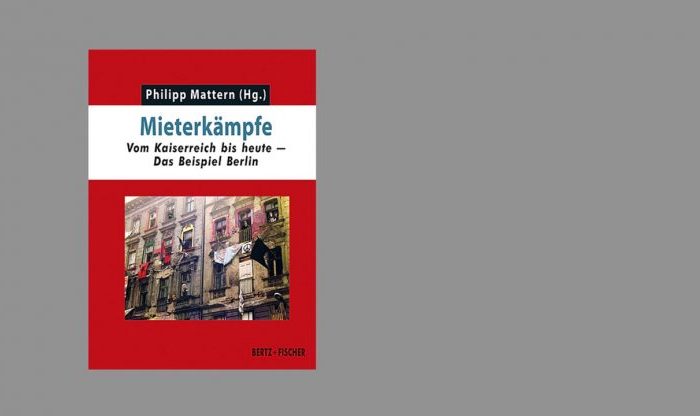Berliner Ringe: eine Stadt zwischen Dorf und Metropole
 Bild: Deutsche FotothekBerlin 1861
Bild: Deutsche FotothekBerlin 1861Wachstumsringe sind Zeugnisse von Berlins 200jähriger Ausdehnung. Ein geschichtlicher Überblick zur Entstehung der Stadt von Jürgen Tietz. Erschienen in OXI 10/20.
Unweit von Schildhorn herrscht ein wuseliges Treiben. Ausgiebig wird unter mächtigen märkischen Kiefern entlang des Havelufers geradelt und gebadet, gejoggt und gesonnt oder einfach nur spaziert. Im Corona-Sommer 2020 noch ausgelassener als sonst. Unbeeindruckt davon schiebt sich gleich daneben der 36 Meter hohe Grunewaldturm empor. So backsteinrot wie weithin sichtbar. 1899 als Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisturm eingeweiht und 1948 neutralisierend zum Grunewaldturm umbenannt, erinnert seine Inschrift nicht nur an seine Widmung an Wilhelm I., sondern zugleich an seine Stifter: »Der Kreis Teltow baute mich 1897«. Teltow? Wieso denn bloß Teltow? Hier, mitten im allergrünsten Zehlendorf, Ortsteil Grunewald? Schließlich steht der Turm auf dem Karlsberg, gut 30 Kilometer entfernt vom Örtchen Teltow. Jenem Teltow, das seinen Eintrag im Buch der internationalen Kulturgeschichte Lyonel Feiningers wunderbaren expressiv-abstrakten Gemälden von Dorf und Kirche verdankt. Jenes Teltow, das heute im immer weitere Einfamilienhaus-Masse ansetzenden Speckgürtel der Hauptstadt liegt, mithin also keineswegs zu Berlin gehört, sondern zum Bundesland Brandenburg.
Zur Bauzeit des Grunewaldturmes war das alles noch anders. Da reichte der einflussreiche und finanziell bestens ausgestattete Kreis Teltow bis hinter Tempelhof und Schöneberg an den südlichsten Rand der preußischen Residenzstadt heran. Doch schon Ende des 19. Jahrhunderts strebten die großen städtischen Agglomerationen des Kreises Teltow nach Autonomie, allen voran Charlottenburg. Seit 1877 selbstständig, zählt es um 1900 als Großstadt bereits über 100.000 Einwohner. Es folgten 1899 Schöneberg und Neukölln (Rixdorf) und 1907 Wilmersdorf. Als im Oktober 1920 schließlich Groß-Berlin entstand, verlor der Kreis Teltow endgültig seine bevölkerungsreichsten Bereiche und damit seine Bedeutung.
In seinem Kapitel über »Berlin in der Weimarer Republik« in der bis heute unübertroffenen »Geschichte Berlins« von 1987 bewertet Henning Köhler die Schaffung von Groß-Berlin als eine »Sternstunde«. Freilich eine, die sich nicht auf eine sonderlich breite Mehrheit stützen konnte. So umstritten der Zusammenschluss politisch und gesellschaftlich damals war, so unverzichtbar war er, um endlich eine effektive Verwaltung in der aufstrebenden Metropole zu schaffen. Anschaulich lässt sich das in der Ausstellung »Chaos und Aufbruch« bis Ende Mai 2021 im Märkischen Museum erleben.
Mit der Gründung von Groß-Berlin 1920 gehörte die Stadt plötzlich zu den drei größten Metropolen der Welt. Zumindest, was die Bevölkerungszahl mit knapp vier Millionen Bewohnern anging. Der urbane Nachholbedarf des bis dahin in lokale Einzelinteressen zersplitterten Berlin war riesig. So schwärmten die Verantwortlichen aus, um von der Welt zu lernen. Ein wunderbarer Film in der Ausstellung im Märkischen Museum zeigt Berlins Verkehrsstadtrat Ernst Reuter, der später Berlins legendärer Nachkriegs-Bürgermeister werde sollte, 1927 auf einer Reise zur Verkehrserkundung in die USA. Doch nicht nur im Verkehr, auch bei Grünanlagen, Bildungseinrichtungen und vor allem beim Wohnen musste die überschnell gewachsene Stadt ganzheitlich und neu organisiert werden. Wie überfällig das 1920 längst war, spiegelt sich auch in der Biografie Franz Schwechtens, dem Architekten des Grunewaldturmes. Selbstredend baute Schwechten nicht nur in und für Teltow, sondern längst in ganz Berlin. Zu seinen bekanntesten Arbeiten mit Ikonencharakter für die deutsche Hauptstadt gehörten die heute nur ruinös erhaltene Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und der ebenso legendäre wie überflüssigerweise nach 1945 weitgehend abgerissene Anhalter Bahnhof. Dessen Vorhallenreste sollen künftig als neues Portal eines geplanten Exil-Museums dienen. Ebenfalls zu Schwechtens (nicht erhaltenen) Arbeiten gehört das wuchtige Landratsamt des Kreises Teltow. Es stand eben nicht im Dorf Teltow, sondern im sogenannten »Alten West«, unmittelbar vor den Toren Berlins, in der Viktoriastraße nahe dem Potsdamer Platz im Tiergarten.
Blickt man heute auf Berlins Forma Urbis, dann fallen die Wachstumskreise auf, in denen sich das Stadtgebiet innerhalb von kaum 200 Jahren ausgedehnt hat. Im Gegensatz zu anderen europäischen Hauptstädten wie London oder Paris war Berlin eine (sehr) späte Stadt. Römische Ursprünge sind an der Spree Fehlanzeige. Stattdessen bemühte man im Klassizismus um 1800 das idealisierende Bild eines vermeintlichen Spreeathens. Dabei war Berlin, von Knobelsdorffs Hedwigskathedrale am Forum Fridericianum, dem heutigen Bebelplatz, bis zu Julius Raschdorffs mächtigem Berliner Dom (zur Abgrenzung vom Deutschen und Französischen Dom Carl von Gontards auf dem Gendarmenmarkt) eigentlich eher dem kuppelbekrönten Vorbild Roms verbunden. Aber egal! Alles, was irgendwie antik daherkam, wurde an der Spree begierig zur Legitimation der eigenen Bedeutung herangezogen. Schließlich war Berlin bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eher dörflich als städtisch geprägt. Noch dem großen Berliner Flaneur Franz Hessel galt die Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ein »märkisches Dorf an der Landstraße zwischen Paris und Moskau«.
Die Weichen für Berlins räumliches Wachstum über sich und sein Grenzen hinaus wurden allerdings deutlich vor der Gründung von Groß-Berlin gestellt. Einen ersten »Berliner Ring« umschrieb jene Pallisaden-»Mauer«, die die barocken Stadterweiterungen ab 1734/37 einfasste. Wachsend atmete sich die Stadt in den folgenden Jahrzehnten immer weiter in ihr Umland hinaus. Spuren der alten Stadtbefestigung zeichnen sich heute noch im Verlauf der Kreuzberger Hochbahntrasse ab, aber auch in Straßennamen wie Linien- und Pallisadenstraße. Anschaulich wird diese »Berliner Mauer«, die vor allem eine Zollmauer war, unweit des Anhalter Bahnhofs in einem rekonstruierten Mauerfragment in der Stresemannstraße. Mit dem Hobrecht-Plan und der Ringbahn entstanden weitere Zirkelschläge um den inneren, mittelalterlich-barocken Kern Berlins. James Hobrecht, der mit seinem Plan 1862 das Straßenskelett samt Kanalisation für die Erweiterung der Stadt entwarf, wurde für sein Konzept später heftig kritisiert. Öffnete er mit ihm doch der extremen Verdichtung der Stadt den Raum für die engen Hinterhöfe in den Berliner Blöcken. Dabei strebte Hobrecht eigentlich eine gemischtere Stadt an. Doch seine Planung wurde von der Zeit und der Terrainspekulation überholt. Darin zeigt sich ein Grundproblem von Stadt. Sie wird für die Dauer, möglichst gar für Jahrhunderte gedacht und gebaut. Zugleich müssen sich Städte an die sich häufig im schnellen Rhythmus von Jahrzehnten verändernden Rahmenbedingungen anpassen können. Diese Balance aus den sich eigentlich widersprechenden Anforderungen zwischen immobiler Statik und flexiblen Nutzungsanforderungen bildet eine stete Herausforderung für das System Stadt.
Bis heute umfasst der 1877 geschlossene S-Bahn-Ring, der von der Trasse der Stadtbahn von Ost nach West (oder umgekehrt) durchmessen wird, das, was für gewöhnlich als Berliner Innenstadt bezeichnet wird. Mit der Gründung Groß-Berlins kam 1920 ein weiterer »Ring« hinzu. Im Zirkelschlag von rund 15 Kilometern vom Stadtkern aus markierte er die neuen Stadtgrenzen. Ergänzt wurden sie durch die »Ausbuchtungen« der großen Berliner Waldgebiete rund um Wannsee und den Müggelsee. Zugleich wurden damit Wilmersdorf und Charlottenburg – gerade erst zu eigenständigen Städten aufgestiegen – oder das große Dorf Pankow mit seinen gut 60.000 Bewohnern zu Berliner Subzentren degradiert. Die 1920 definierten Stadtgrenzen haben sich über die Zeit der deutschen Teilung bis heute erhalten. Mit der Konsequenz, dass sich an die großstädtischen Hochhaussiedlungen der Nachkriegsmoderne von Marzahn über die Gropiusstadt bis zum Märkischen Viertel nur wenige Meter entfernt nahezu ländliche Strukturen anschließen.
Mit der Gründung von Groß-Berlin war der dynamische Wachstumsprozess Berlins allerdings keineswegs abgeschlossen. Vielmehr diente er als Impuls für das innere Wachstum. Die großen Industrieunternehmen der Stadt wie Siemens, Borsig oder AEG entwickelten ihre Produktionsstandorte weiter, Werkssiedlungen wie die legendäre Siemensstadt inklusive. Doch auch außerhalb des neuen Stadtverbundes regten sich im Berliner Umland durch diesen Impuls Wachstumsbestrebungen. Warum sollten Städte wie Brandenburg an der Havel oder Luckenwalde nicht als Satelliten am Berliner Wachstum teilhaben? So wie Ende des 19. Jahrhunderts in den aufstrebenden Städten Charlottenburg, Steglitz und Schöneberg repräsentative neue Rathäuser errichtet wurden, entstanden während der 1920er Jahre in Brandenburgs Städten neue öffentliche Bauten. In den Formen der Moderne entworfen, drückten sich in ihnen bürgerliches und soziales Selbstbewusstsein und ein neuer Anspruch der Städte aus.
Doch Berlins dynamisches Wachstum wurde bekanntlich jäh gestoppt. Die Grenzen von 1920 wurden nach 1945 erst politisch, dann materiell betoniert, die wirtschaftliche Verflechtung von Berlin und seinem Umland zerschnitten. Das änderte sich erst wieder mit der deutschen Einheit 1990. Seitdem hat sich beispielsweise Brandenburg an der Havel von einer halb verfallenen, grauen Stadt zur sanierten Schönheit an der Spree mit Wachstumspotenzial herausgeputzt. Als Ausflugsdestination ebenso beliebt wie als hauptstadtnaher Wohnort für all jene, die sich weder im übertouristisierten Zentrum der Stadt niederlassen wollen, noch im Einfamilienhausgrauen des unmittelbaren Berliner Speckgürtels. Regelmäßig fluten zahlreiche Stadtbewohner an den Wochenenden Richtung Königs Wusterhausen oder Uckermark und springen dabei über den äußersten aller Berliner Ringe, den Autobahnring der A 10.
Obgleich faktisch in vielen Bereichen verflochten, lässt die sinnhafte Entwicklung eines baulich wie verkehrlich und sozial integrierten Großraums Berlin-Brandenburg auch dreißig Jahre nach der deutschen Einheit weiter auf sich warten. Hatte man 1920 die Gunst der Stunde in der Umbruchzeit nach dem Ersten Weltkrieg für eine politische und verwaltungstechnische Neuordnung beherzt ergriffen, so ließ man diese Chance nach 1990 ungenutzt verstreichen. Anstelle eines eng verwobenen und zugleich differenzierten politisch-kulturellen Zusammenspiels von Berlin und Brandenburg herrscht provinzielles Klein-Klein vor. Um existenzielle Fragen der künftigen Funktion von Städten in der Interaktion mit den ländlichen Räumen und auch ganz praktische Fragen nach bezahlbarem Wohnraum, Verkehrsanbindung und angemessener Balance aus Verdichtung und Freiräumen ökonomisch und ökologisch zu lösen, ist dieser gesamtheitliche Blick auf die Region jedoch unverzichtbar. Eine integrierte Entwicklung von Stadt und Land, von Zentren und Peripherien muss eine der grundlegenden Schlussfolgerungen aus der aktuellen Pandemie sein. Innenverdichtung auf Teufel komm raus, die zu vormodernen Zuständen zurückführt, kann jedenfalls nicht die Lösung für Wohnungsnot und nötige Frischluftschneisen darstellen. Das legendäre Bonmot des Schriftstellers Karl Scheffler, Berlin sei dazu verdammt, immer zu werden und nie zu sein, gilt also weiter an der Spree – aber nicht nur dort. Beschreibt es doch jenen permanenten Veränderungsprozess, dem die meisten Großstädte ausgesetzt sind. Da passt es blendend, dass die beiden Architektenkammern in Brandenburg und Berlin das Jubeljahr 2020 als Impuls für eine gemeinsame Internationale Bauausstellung begreifen, um die anstehenden Transformationsprozesse in Stadt und Land gut und gemeinsam zu gestalten.
Die Befürchtung, dass von einem Berlin-Brandenburger Zusammenschluss die Gefahr einer übermäßigen Zentralisierung ausgeht, erscheint überzogen. Ja, im Zukunftsteil der Ausstellung des Stadtmuseums »Chaos und Aufbruch« wird sogar über ein gemeinsames Bundesland zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern nachgedacht. Damit wäre der erste Schritt zum Tucholsky-Ideal »vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße« endlich erreicht.
Für Berlin gilt, dass selbst nach der Bezirksreform von 2001 die Identifikation mit den historischen Bezirken nicht gelitten hat. Grundsätzlich gilt bis heute, dass Spandau eben nicht in, sondern nur bei Berlin liegt, und für die Köpenicker liegt Dahlem ähnlich weit entfernt wie der Mond. Was übrigens auch umgekehrt gilt. Berlin war und ist stets viele Städte. Die Stadt war schon immer heterogen und polyzentrisch – und ist es bis heute geblieben. Jenseits des Verwaltungshandelns, in dem jeder Stadtbezirk so gut, wie er kann, gegen den Senat bockt, was übrigens ebenfalls ein Erbe der Verwaltungsreform von 1920 ist, spielen in Berlin vor allem die Kieze eine zentrale Rolle. Der eigene Kiez rund um den Dorfanger, gerne mit kleiner mittelalterlicher Feldsteinkirche und großer backsteinsichtiger Ergänzung des 19. Jahrhunderts, bildet in der Millionenstadt den wichtigsten lokalen Referenzpunkt. Baulich wie mentalitätsmäßig muten die Berliner Quartiers- und Kommunikationsstrukturen geradezu dörflich an, irgendwo zwischen kleinteilig und kleinkariert. Die Ursache für diese Berliner Kiez-Mentalität führt bis 1920 zurück, zur additiven Entstehung der Stadt. So lebt Berlin bis heute aus seiner lokalen Unterschiedlichkeit. Sie ist für die Stadt ebenso charakteristisch wie ihre stete Ambiguität aus Kontinuitätssehnsucht und Transformationsnotwendigkeit.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode