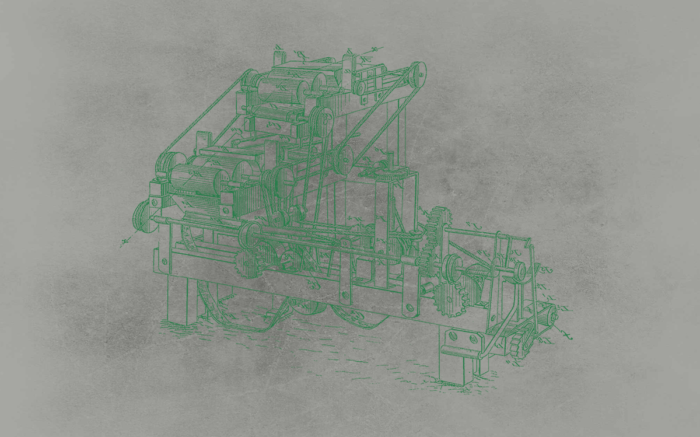Ein Topf Farbe und die Logik des Marktes: Über Gebrauchswert und Tauschwert in der Kunst
 GemeinfreiBilder von Amedeo Modigliani bei der Biennale in Venedig 1930
GemeinfreiBilder von Amedeo Modigliani bei der Biennale in Venedig 1930In dieser Woche wurde Max Beckmanns Gemälde »Die Ägypterin« in Berlin für 4,7 Millionen Euro versteigert – der bisher höchste Erlös bei einer Kunstversteigerung in Deutschland. Aber wie kommt so eine Summe zustande? Was ist ein angemessener Preis für ein Kunstwerk?
Es ist der bisher höchste Erlös bei einer Kunstversteigerung in Deutschland: In dieser Woche wurde Max Beckmanns Gemälde »Die Ägypterin« in Berlin vom Auktionshaus Villa Grisebach für 4,7 Millionen Euro versteigert; nebst Aufgeld werden insgesamt 5,5 Millionen Euro fällig. »Das 1942 in Holland entstandene Porträt wurde zunächst auf einen Wert von mindestens zwei Millionen Euro geschätzt. Das Bild stammt aus dem Nachlass von Barbara Göpel, einer engen Freundin des Malers, die das Werkverzeichnis des Künstlers erstellte«, berichtet der RBB.
Fast fünf Millionen Euro für ein Gemälde? Und das ist ja nicht einmal die Oberklasse der Preise bei Kunstauktionen. Das aktuell teuerste Gemälde der Welt ist ein Jesus-Porträt von Leonardo da Vinci: »Salvator Mundi« (Retter der Welt) wurde im November 2017 vom Auktionshaus Christie‘s für 450.312.500 US-Dollar versteigert: 450 Millionen US-Dollar.
Wie kommt so eine Summe zustande? Was ist ein angemessener Preis für ein Kunstwerk? Die Frage nach dem ästhetischen und ökonomischen Wert zum Beispiel eines Gemäldes ist gar nicht so einfach zu beantworten – obwohl sie schon recht alt ist.
Sie stand auch im Zentrum eines der vielleicht berühmtesten Streitfälle über den Preis eines Kunstwerks – ausgetragen 1877 zwischen dem Maler James McNeill Whistler und dem Kunstkritiker John Ruskin. Der hatte sich abfällig über Whistlers »Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket« geäußert. Das Gemälde zeigt ein nächtliches Feuerwerk über Cremorne Gardens, die Szene ist düster, Farbpunkte der Ölarbeit veranschaulichen die Phasen der zur Belustigung abgeschossenen Raketen.
Einen Geck zweihundert Guineen fordern hören
Als prominenter Kunstkritiker war Ruskin außer sich – vor allem darüber, dass für das seiner Ansicht nach schlechte Gemälde eine Menge Goldmünzen verlangt wurden. Ruskin sprach von »mutwilliger Hochstapelei«, er habe noch nie erlebt, »einen Geck zweihundert Guineen fordern zu hören, dafür dass er dem Publikum einen Topf Farbe in das Gesicht schleudert«. Whistler war über diese Beleidigung empört, forderte 1.000 Pfund Schadenersatz und die Sache kam vor Gericht: Sind 200 Guineen ein angemessener Preis für das Bild?
»Im Kreuzverhör mit Ruskins Bevollmächtigtem Sir John Holker und auf Nachfrage des Richters bestätigte Whistler, dass Künstler für ihr Geld den vollen Gegenwert lieferten«, so hat der Kunsthistoriker Grischka Petri den Fortgang des Prozesses einmal beschrieben. »Für Ruskin bedeutete dies den moralisch-ökonomischen Gegenwert: die aufgewandte Arbeitszeit. Holker fragte in diesem Sinne, wie lange Whistler gebraucht habe, das umstrittene Gemälde fertigzustellen. Auf Whistlers Antwort, er habe dazu zwei Tage benötigt, entwickelte sich der berühmteste Wortwechsel der Verhandlung. Holker: ›Ist es die Arbeit von zwei Tagen, für die Sie zweihundert Guineen verlangen?‹ – Whistler: ›Nein. Ich verlange sie für das Wissen, das ich bei der Arbeit eines Menschenlebens erworben habe.‹«
Wir wissen, dass die Zuschauer der Verhandlung seinerzeit derart positiv auf Whistlers Einlassung mit Applaus reagierten, dass der Richter die Räumung des Gerichtssaals androhte. Was wir nicht wissen, ist, ob Karl Marx die Kontroverse verfolgt hat.
Ob Karl Marx die Kontroverse verfolgt hat?
»Obwohl es nahe gelegen hätte, auch am Beispiel der Warenförmigkeit des Kunstwerks Probleme der kapitalistischen Ökonomie zu erörtern, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts zumal in Großbritannien, wo Marx lebte, angesichts des dort expandierenden Kunstmarktes für ihn eine theoretische Herausforderung hätten sein können«, so kann man im Historisch-Kritischen Wörterbuch des Marxismus nachlesen, »fehlt in seinen Schriften jeglicher Hinweis auf dieses Thema, was umso bedauerlicher ist, als er an ihm zudem das komplizierte Ineinander von Ideologie und Ökonomie hätte analytisch entwirren können.«
Das haben nichtsdestotrotz viele andere versucht, wie in einem Kaleidoskop fügen sich so Steine verschiedener Ansätze zu einer politischen Ökonomie der Kunst zusammen. Sphären sind dabei miteinander verflochten, sie beeinflussen sich gegenseitig, bleiben bisweilen widersprüchlich aufeinander bezogen.
Die obersten Etagen jenes Marktes zum Beispiel, auf dem immer höhere Preise für ausgewählte Werke erzielt werden, wird man dabei nicht nur als finanzkapitalistische Angelegenheit analysieren, in der ein Kreislauf der spekulativen Preissteigerung und der »Wertaufbewahrung« in Gang gehalten wird. Wer hier verkauft wird, steigert nicht nur seinen »Marktwert« als Künstler, sondern erhöht auch seine Chancen, dass seine Werke von Museen angekauft werden. Dies wiederum läuft als eine »Transformation des pekuniären Parameters in den ideologischen« Faktor: Mit der Musealisierung werde die Kanonisierung besiegelt, so etwa der Kunsthistoriker Norbert Schneider. Die Stellung des Künstlers zum Kanon wiederum wirkt auf eine sich rationalen Kriterien meist entziehende Preisbildung zurück.
Auf dem Kunstmarkt in ökonomisches Kapital übertragbar
Ein anderes Beispiel für die Verflechtungen verschiedener Motive kann man bei Pierre Bourdieu nachlesen, der in seinem Ansatz das symbolische Kapital dem ökonomischen Kapital überordnet, die Akkumulation des Ersteren aber mit der Verfügbarkeit über das Letztere steigt. Prestige und die Stellung in einer Rangordnung des Sozialen sind dann auch eine Sache des Geldes, mit dem man sich die Insignien erkaufen kann, aus denen sich eine besondere Reputation ergibt, die sich wiederum auch – etwa über »Markennamen« von Künstlern – auf dem Kunstmarkt in ökonomisches Kapital übertragen lässt.
Dabei fallen nicht nur die gesellschaftlichen Rollen bisweilen in einer Person ineinander, auch verschiedene Dimensionen des »Werts« überlagern sich. Damien Hirsts mit über 8.600 Diamanten besetzter Platinabguss eines Schädels etwa hat schon einen enormen Materialwert, als Kunstwerk wurde er 2007 für 75 Millionen Euro verkauft, Hirst selbst aber war Mitglied der Käufergruppe – und damit »Produzent, Vermittler und Sammler in einer Person«, wie es der Kunsthistoriker Philip Ursprung formulierte. Mit enormem Aufwand wurde zudem eine Marketingkampagne betrieben, die eine Sekundärverwertung des Schädels antrieb.
Von einem Kunstmarkt in dem heute noch begreiflichen Sinne kann man eigentlich erst seit dem 17. Jahrhundert sprechen. Damals schufen in den Niederlanden selbstständige Künstler bereits jährlich rund 70.000 Bilder für Käufer, von denen sie vorher nicht wussten, wer es sein könnte und wie viel sie bezahlen würden. Natürlich hatte sich das alte System der Auftragswerke durch kirchliche oder weltliche Mächte erhalten. Aber nun trat eine neue Form hinzu, bei dem ein »System der Preisbildung von Kunstwerken als austauschbaren, fungiblen Gütern, mithin Waren« wirkte (Norbert Schneider). Das blieb wiederum nicht ohne Einfluss auf die Kunst selbst, mit der Steigerung der Nachfrage veränderte sich auch die Produktion der Kunstwerke – bis auf die ästhetische Ebene.
Die spezielle Weise, in der Preise gebildet werden
Mitte des 18. Jahrhunderts kamen Auktionshäuser auf. 1744 wurde Sotheby’s von Samuel Baker in London gegründet; im Jahre 1766 folgte eben dort auch die erste Versteigerung bei Christie’s. Die spezielle Weise, in der hier Preise gebildet werden, also in Bieterwettbewerben, ist für den Markt vor allem Bildender Künste prägend – jedenfalls für das Spitzensegment. Wenn ein einzelnes Haus wie Christie’s im Jahr 2017 einen Jahresumsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar macht, deutet sich da auch schon eine globale Dimension an: Einer aktuellen Studie von Clare McAndrew zufolge lag der Gesamtwert der weltweiten Verkäufe 2017 bei 64 Milliarden US-Dollar, knapp 34 Milliarden entfielen dabei auf Galeristen und Kunsthändler, rund 29 Milliarden auf die Auktionshäuser.
Entscheidend ist bei diesen Zahlen aber der Vergleich mit früheren Jahren. 2009 wurde der weltweite Umsatz auf dem Kunstmarkt noch mit 40 Milliarden US-Dollar taxiert. »Viele neue Millionäre aus Asien oder Amerika drängen in den Markt, überall in der Welt entdecken Reiche Kunst als Investitionsobjekt«, schrieb unlängst das »Handelsblatt« und fragte: »Tut sich da eine gigantische Spekulationsblase auf?«
Das kann schon sein. Die Frage nach dem seltsamen Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert von Kunstwerken wäre damit aber noch nicht abschließend beantwortet. Nach Arnold Hauser verwandelt der Markt »das Kunstwerk, dessen Bedeutung vorher in einem ›Gebrauchswert‹ bestand und sich aus dem Vergnügen, der Lust und Wonne ergab, die es dem Betrachter bereitete, in das Substrat eines Tauschwerts. Es wird nicht mehr nach seiner ästhetischen Qualität beurteilt«.
Was ist dann mit dem Eigensinn der Kunst?
Aber was ist dann mit dem Eigensinn der Kunst, mit ihrem Autonomiecharakter, dem Selbstverständnis als oppositionelle Avantgarde, was mit Richtungen, die eine an Karl Marx orientierte Kritik in ihre Arbeit aufnahmen?
Sie blieben und bleiben in doppeltem Sinne Möglichkeiten: nach der einen Seite offen in Richtung Verweigerung gegenüber dem Markt, nach der anderen Seite immer in der Gefahr, trotzdem von diesem aufgesogen zu werden. Die ökonomische Logik ist eine, vor der man nicht fliehen kann – der berühmte »stumme Zwang«. Er wirkt auch auf widerständische Kunst oder die Kunst des Neinsagens, weil diese ebenso auf ökonomischen Voraussetzungen gründen. Diese lassen sich vielleicht durch öffentliche Kulturpolitik abfedern, gestalten, mildern. Aber wie viel Widerstand steckt noch drin in einer Arbeit, die jener Staat bezahlt hat, der da kritisiert werden soll? Auch das ist, in einem sprichwörtlichen Sinne, der Preis der Kunst.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode