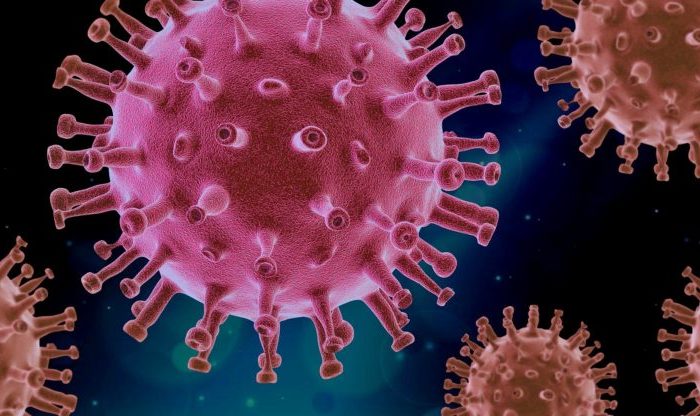Es kommt verdammt auf das Ganze an
 OXI
OXIZehn Jahre nach seiner Gründung zieht das Institut Solidarische Moderne Bilanz und blick nach vorn – skeptisch in der Analyse der Lage, optimistisch im Ausblick darauf, was möglich sein könnte.
Es gab Zeiten, da drehten sich rot-rot-grüne Debatten um reale Mehrheiten. Nach den Bundestagswahlen 2005 etwa, als es eine Mehrheit der Mandate von SPD, Grünen und PDS gab, diese Option aber nicht gezogen wurde. Dass bei den Wahlen 2009 die Sozialdemokraten wie ein gerupftes Huhn aus der »Großen Koalition« gingen, in die stattdessen geflohen war, hat Häme nach sich gezogen. Aber politisch ist das keine Münze, die wirklich zählt.
Und so war es folgerichtig, dass sich Anfang 2010 gleich mehrere Versuche regten, für das nächste Mal besser vorbereitet zu sein. Jüngere Bundestagsabgeordnete aus SPD, Bündnisgrünen und Linkspartei brachten die so genannte Oslo-Initative in die Spur. Und in Berlin wurde das Institut Solidarische Moderne aus der Taufe gehoben. Politische Schnittmengen ausloten, transformative Politik wissenschaftlich begleiten, die Debatte zwischen verschiedenen organisatorischen Registern ermöglichen, die Verschiedenheit der »Mosaiklinken« als Ressource begreifen, nicht nur auf Mandate, sondern auch auf gesellschaftliche Mehrheiten blicken.
Zehn Jahre später hat das Institut Solidarische Moderne nun Bilanz gezogen. Die fällt vergleichsweise kurz aus, was damit zu tun haben mag, dass das Netzwerk vor allem an einer progressiven Bearbeitung der politischen Herausforderungen interessiert ist. Und das hat mehr mit Zukunft zu tun als mit Vergangenheit.
Der Ausblick des Instituts ist deshalb auch der spannendere Teil – denn die Umstände, unter denen die »doppelte Aufgabe« einer »radikaldemokratischen und sozialökologischen Transformation der bestehenden Verhältnisse« ins Werk gesetzt werden sollen, haben sich doch einigermaßen drastisch verändert. Erstens ist »die jahrelang stabile rot-grün-rote Umfragemehrheit verdampft«, zweitens stecken zwei der mit dieser Farbenlehre bezeichneten Parteien nicht eben im Aufschwung, um es zurückhaltend zu formulieren. Drittens der gesellschaftliche Rechtsruck, der sich in einer »manifesten Verschiebung nicht nur des Migrations-, sondern einiger anderer politischer Diskurse auf konservative oder offen reaktionäre Positionen niedergeschlagen hat«. Der hiergegen formierte »erzwungene permanente Abwehrkampf« bindet Energien.
Das »dissidente Drittel« ist rege, laut und aktiv
Auf der anderen Seite ist das, was beim Institut »dissidentes Drittel« genannt wurde, durchaus rege, laut und aktiv. Verschoben haben sich zum Teil die politischen Formationen, in denen das zum Ausdruck kommt. Siehe etwa den Aufstieg der Grünen gegenüber vor allem der SPD oder die Rolle, die neue soziale und zivilgesellschaftliche Bewegungen einnehmen. Die »linken, solidarischen oder allgemeiner die progressiven Teile der bundesrepublikanischen Gesellschaft« mögen dabei rein zahlenmäßig erst einmal Minderheit sein, aber es hängt eben von der politischen Stärke, von den realen Eingriffschancen und der Repräsentation dieses »dissidenten Drittels« ab, ob sich andere, die noch schwanken, für eine solche »radikaldemokratische und sozialökologische Transformation der bestehenden Verhältnisse« erwärmen, ja: entscheiden könnten. Dann sind auch politische Mehrheiten wieder möglich.
Etwas, das schon immer zur programmatischen DNA des Instituts gehört, das aber seit 2015 eine neue, zentralere Rolle in allen politischen Auseinandersetzungen spielt, ist der globale Horizont des Veränderungsansatzes: »Die politische Lektion der Migrations- wie der ihnen verbundenen Willkommensbewegungen liegt im Nachweis der Notwendigkeit, die unumgänglich globale Dimension heutiger Gerechtigkeitspolitiken in den Blick zu nehmen«, schreibt das Institut zum Zehnjährigen. Dasselbe gilt für jede Politik gegen die Klimakrise, das weltweite Armutsgefälle, der Krise der internationalen Ordnung. »Wohin man auch sieht, immer geht es darum, dass Gerechtigkeitspolitiken als der Kern linker Projekte eigentlich stets in globalisierter Dimension gedacht werden müssen – oder aber gar keine Gerechtigkeitspolitiken und damit auch gar nicht mehr ›links‹ sein können.«
Warum links global denken muss
Das muss man nicht als Absage an transformatorische Politiken auf nationalstaatlicher Ebene sehen. Dort werden sie beginnen müssen, kleinräumiger sogar noch eher, auf regionaler, auf Landesebene. Entscheidend ist die Anerkenntnis einer Begrenztheit, die Wahrnahme der Tatsache, dass Veränderung und die dieser dienenden politischen Entwürfe nicht an diesem nationalstaatlichen Tellerrand hängen bleiben dürfen. Oder in den Worten des Instituts: »Wer die soziale Frage in der Bundesrepublik vordringlich im nationalen Rahmen stellt, entwirft seine Politik, ob gewollt oder nicht, als Politik für die im Weltmaßstab privilegierten Bewohner*innen des globalen Nordens und in Verteidigung ihrer Privilegien.« Hieran schließt sich, so argumentiert das Institut, geradezu zwangsläufig eine Politik der Grenzsicherung um jeden Preis und deren Folgen für dass Leben von Menschen an.
Wie also es anders machen? Man könnte es einfach so formulieren: Unter der Fahne von Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot (es geht hier wie gesagt nicht nur um Parteien-Arithmetik, sondern eine darüber hinausgehende sowohl programmatische als auch organisatorische Idee) mit Realpolitik das Mögliche tun, damit den Unterschied zu anderen politischen Mehrheitsprojekten deutlich machen, darüber hinaus Einstiegsprojekte Realität werden lassen, die über den Rahmen des »nur besseren« Status quo hinausweisen.
Einstieg im Jetzt, Projekte der Zukunft
Die »Transformation«, um die es dem Institut geht, ist nichts, was man in einer Legislaturperiode schaffen könnte, sondern wird als lange und mehrdimensionaler »Prozess der Gesellschaftsveränderung« über »alles hinausgehen«, was eine Regierung leisten kann. Aber ohne die Leistung einer Regierung wäre die Transformation ohne wirksamen Beginn. Noch einmal das Institut, das »unter global ausgespannten Gerechtigkeitspolitiken auf der Höhe unserer zunehmend dramatischen Zeit nach wie vor eine ganz realpolitische Sache« versteht: Tatsächlich verlange man von einer progressiven Mitte-Links-Koalition auf Bundesebene »nur« den Einstieg.
Dieser wäre aber auch nicht nichts. Es gehe »dabei um Dinge, die in den Programmen der Grünen, der SPD und der Linken, auch in denen vieler Gewerkschaften längst ihren Platz gefunden haben – vom Mindestlohn über die Bürger*innenversicherung, das sanktionsfreie Grundeinkommen, die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bis zu einer Bildungsoffensive und einer entschlossenen Beschleunigung, Vertiefung und Ausweitung der Energie- und Mobilitätswende. Dazu bedarf es auch einer neuen Finanzarchitektur für Deutschland und Europa. Es bedarf der Revision der Schuldenbremse, um ein sozial-ökologisch-kulturelles Investitionsprogramm in Europa zu ermöglichen. Es bedarf schließlich einer Finanztransaktionssteuer, die ihren Namen verdient.«
Soweit, so realpolitisch. Und doch ist es auch das Einfache, das schwer zu machen ist. Oder sagen wir: schwer zu beginnen ist. Ein wirklicher Beginn aber sollte es sein, und damit dies deutlich wird, wünscht sich das Institut »darüber hinaus zwei, drei, vier Projekte, die es wagen, zumindest ein paar Schritte über den damit gezeichneten Horizont hinauszugehen«. Ideen dazu gibt es, und es wäre gut und im Sinne der Veränderung, wenn über solche »transformatorischen Leuchttürme« mehr gesprochen würde, wenn Projekte gesammelt und vorgeschlagen würden, in denen dieser utopische Überschuss wohnt, die aber schon im Jetzt zu machen sind, und zugleich über die Begrenztheiten des Jetzt hinausweisen. Projekte, die Lernen zwischen politischen Partnern ermöglichen, die bei aller Bündnisfähigkeit dennoch unterschiedlich sind. Ideen, anhand derer sich Erfahrungen zum Wechselspiel von Regierung, Parteien, sozialen Bewegungen, lokalen UmsetzerInnen machen ließen.
Die nächsten Wahlen
Der zeitliche Horizont ist dabei einerseits sehr nah und andererseits, wie schon gesagt, ein recht weit gefasster. 2021 sind turnusmäßig die nächsten Bundestagswahlen. Es dürften Wahlen der Entscheidung sein, eine Abstimmung, bei der es nicht nur um Varianten des Ähnlichen geht, sondern um grundlegend unterschiedliche Richtungen der gesellschaftlichen Entwicklung. Es geht, in den Worten des Instituts, »ums Ganze«. Und damit wären wir auch wieder bei zehn Jahren Institut Solidarische Moderne und die weiter zurückreichenden Traditionen, aus denen sich 2010 diese Idee auch speiste: Rot und Grün.
»Es ist zugleich eine Tradition, die in der Zeit, in der sie auf der Bundesebene schon einmal zum Zug kam, kein Versprechen, sondern nur Enttäuschungen zurückgelassen hat«, schreibt das Institut – und lässt den Kopf dennoch nicht hängen. »Trotzdem gibt es diese Tradition, und genau besehen war sie nie so angesagt wie in diesen gleich mehrfach erschreckenden, aktuell sogar furchterregenden Zeiten. Es käme schlicht und einfach drauf an – ja, es käme, es kommt verdammt auf das Ganze eines grünen und roten Aufbruchs an, auf das Ganze, das nicht nur mehr als seine Parteien, sondern auch mehr als seine Gewerkschaften, seine zivilgesellschaftlichen Verbände, seine sozialen Bewegungen ist.«
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode