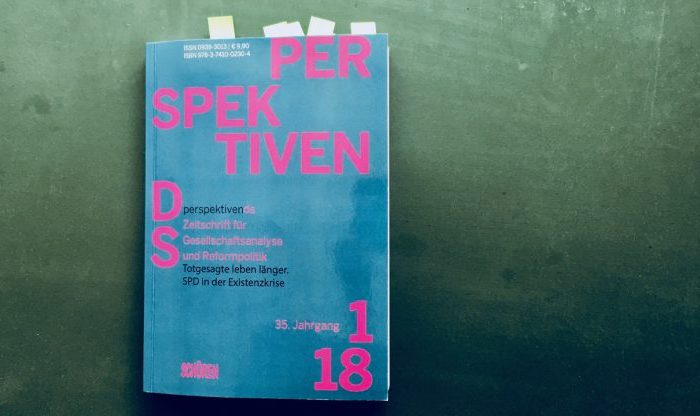Gabriels Sozialdemokratie, die soziale Moderne und die Politische Ökonomie
 Olaf Kosinsky, Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE
Olaf Kosinsky, Lizenz: CC BY-SA 3.0 DESigmar Gabriel fordert eine »Kurskorrektur« der SPD, heißt es jetzt überall. Die Substanz seines Spiegel-Beitrags, an dem man viel kritisieren mag, wird damit aber verfehlt. Er wirft eine Frage auf, die auf die Grundlagen von Sozialdemokratie überhaupt zielt.
Sigmar Gabriel gehört zwar nicht dem Sondierungsteam der SPD an, dass sich der Außenminister deshalb mit Wortmeldungen zurückhalten würde, konnte man freilich nicht erwarten. Kaum hat Martin Schulz grünes Licht für die Gespräche mit Angela Merkels Union erhalten, erscheint im »Spiegel« ein Gastbeitrag seines Vorgängers im sozialdemokratischen Parteiamt, dem sogleich erste Agenturmeldungen folgen: »Gabriel fordert SPD zu Kurskorrektur auf«.
Dass in der Nachricht zu lesen ist, der Niedersache fordere »eine offene Debatte über Begriffe wie ›Heimat‹ und ›Leitkultur‹« wird wahrscheinlich einen Teil der Reaktionen prägen. Und ja, man darf sich darüber aufregen, dass Gabriel den Jubel über die Ehe für alle gegen die gebremste Freude über den Mindestlohn ausspielt. Auch muss Gabriel mit Schlagzeilen wie »zu viel liberale Postmoderne« gerechnet haben, er kennt die Mechanismen des politisch-medialen Betriebs. Und so bleibt im Ohr vieler wohl nur hängen: Ex-SPD-Chef klagt, Sozialdemokraten »haben die Arbeiter vernachlässigt«.
Manches davon führt aber an der Substanz des zweiseitigen Beitrags vorbei. Denn es geht Gabriel darin anders als bei vorherigen Wortmeldungen nicht darum, jetzt mal eben mit ein paar Signalwörtern Anklang bei Wählerschichten zu finden, für die diese Begriffe zu Selbstbestätigungsvokabeln einer Weltsicht geworden sind: »Das wird man ja wohl noch gut finden dürfen!«
Gabriel schließt auch keineswegs aus der Analyse globalisierter ökonomischer und politischer Bedingungen auf eine Beschränkung auf nationalstaatliche Handlungsspielräume. Im Gegenteil. Gabriel schlussfolgert, nur mit mehr internationaler, vor allem europäischer Zusammenarbeit werde man »das zentrale Versprechen der Sozialdemokratie wieder einlösen« können: »nämlich den Kapitalismus zu zähmen und soziale und auf Solidarität ausgerichtete Marktwirtschaften zu erzeugen«. (Man könnte das Versprechen auch anders formulieren, aber das ist eine andere Geschichte.)
Der Hinweis auf europäische Zusammenarbeit ließe sich als Zaunspfahlwink in der Debatte um die EU-Reformvorschläge von Emmanuel Macron lesen, immerhin amtiert der Mann noch als Außenminister. Auch ließe sich Gabriels Text als Beitrag zur Diskussion über eine mögliche kommende »Große Koalition« missverstehen. Aus einer Formulierung wie »Umwelt- und Klimaschutz waren uns manchmal wichtiger als der Erhalt unserer Industriearbeitsplätze, Datenschutz war wichtiger als innere Sicherheit«, könnte man herauslesen wollen, Gabriel ermahnte seine Partei, hier gegenüber irgendwem Zugeständnisse zu machen.
Ein Schlüsseltext der Sozialdemokratie
Aber Gabriels Beitrag ist eher etwas anderes, oder vorsichtig formuliert – könnte es werden: ein Schlüsseltext der Sozialdemokratie. Nicht, weil da etwas besonders Neues darinstände oder unerhörte Thesen oder theoretische Grenzüberschreitungen. Eher formuliert Gabriel die Essenz einer seit einigen Jahren geführten unter verschiedenen Linken geführten Debatte aus und holt eine Spielart davon sozusagen in den Bauch der SPD hinein. Was sind die Kernpunkte?
Erstens: Die Abwanderung von einst sozialdemokratischen Wählern interpretiert Gabriel nicht als »antimoderne Auflehnung«, sondern im Gegenteil: als »Ausdruck einer Sehnsucht nach genau dieser Moderne«. Man muss hier an den Begriff der »sozialen Moderne« denken, wie er etwa von Oliver Nachtwey der in der »Abstiegsgesellschaft« formuliert wurde: »Die ›soziale Moderne‹, die für sozialen Aufstieg und Integration stand, ist vergangen und an ihre Stelle eine Gesellschaft des sozialen Abstiegs, der Prekarität, verschärfter Krisen und Konflikte getreten.«
Gabriel nimmt diesen Gedanken auf, beschreibt die »regressive Moderne« (Nachtwey) allerdings als »Postmoderne« – gegen deren »Anything goes« sich nun auch rechtspopulistisch kanalisierter Krawall richte. In ihm stecke eine Sehnsucht nach der guten alten sozialdemokratischen Zeit, die nicht nur Absicherung, sondern auch Ordnung versprach. Es gehe vielen weniger um mehr materielle Zuwendungen als um sozialpsychologische Einbettung, »um eine kulturelle Haltung und um Fragen nach Identität«.
Zweitens: Die gesellschaftliche Linke, ein inzwischen nicht nur durch die Eribon-Debatte popularisierter Topos, habe sich zu wenig um die »Verlierer« gekümmert, die Arbeiter vornehmlich, was mit dem eigenen, biografischen Aufstieg aus der Lebenswelt dieser Klasse zu tun habe. In den Worten des SPD-Mannes: »Die Mehrheit von uns hat auch ihren gesellschaftlichen Aufstieg gemacht und lebt meist nicht mehr in den Stadtteilen, in denen dieser Teil unserer Wählerschaft wohnt.« (Hierzu ist dieser Text von Franz Walter über die fatalen Ambivalenzen des Projekts der sozialdemokratischen Chancengesellschaft zu empfehlen.) Gabriel weiter: »Auch wir haben uns kulturell als Sozialdemokraten und Progressive oft wohlgefühlt in postmodernen liberalen Debatten.« Die Folge: »Bei uns gibt es oftmals zu viel Grünes und Liberales und zu wenig Rotes.« Daraus ist in anderen Parteien die Schlussfolgerung gezogen worden, man müsse eine neue Klassenpolitik veranstalten, die das eine mit dem anderen (besser) verbindet.
Drittens: »Die Idee der Sozialdemokratie fußt seit mehr als 150 Jahren auf gemeinsamer Interessenvertretung, auf kollektivem Handeln und einer auf Solidarität ausgerichteten Gesellschaft«, so Gabriel. Davon sei »wenig übrig«, woran diese Verluste liegen, sagt Gabriel nicht, aber er schreibt: »Individualisierte Lebensvorstellungen sind weit prägender als früher. Und der Nationalstaat kann seine Wohlfahrtsversprechen nicht mehr einlösen. Zugespitzt: Fast alle Bedingungen für den sozialdemokratischen Erfolg in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts sind verschwunden.« Den Grund dafür sieht er, auch das ist inzwischen ein Standard, in den durch Globalisierung und Digitalisierung beschleunigten Veränderungen.
Atomisierung von Arbeits- und Lebenswelten
Viertens: Gabriel verknüpft die kulturelle Trennung mit der ökonomischen Seite, hier ist er recht nahe bei Nancy Fraser, die eine »neue Linke« fordert, wozu sich die »alte« erst einmal vom »progressiven Neoliberalismus« verabschieden müsse. Die lebensweltliche und ideelle Trennung zwischen sozialdemokratischen Aufsteigern und Wählern »vollzog sich im Gleichtakt mit einer radikalen Liberalisierung der Wirtschafts- und Lebensverhältnisse, die die letzten 30 Jahre charakterisiert hat«, so Gabriel. Weiter: »Verbindlichkeit und Verbindendes galten auf einmal als Hindernis für die Entfaltung der für den Wettbewerb in der Globalisierung notwendigen Flexibilität und Mobilität.«
So eine Denkweise ist einerseits anschlussfähig an oft gehörte Behauptungen, offene Grenzen oder eine internationalistische Denk- und Kulturweise seien praktisch trojanische Pferde kapitalistischer, neoliberaler Radikalisierung. In ihr steckt – bei Fraser zumal – die Idee einer »wahren Linken« (zu der es dann immer eine »falsche« geben muss, eine Teilung, die man als linke Paradedisziplin bezeichnen kann), die zwar die Verbindung von kulturellen Kämpfen um Autonomie, Freiheit, Selbstverwirklichung mit den sozialen Auseinandersetzungen fordert, der aber immer ein Sound anhaftet, Werte wie Diversität, Inklusion, Gleichstellung seien zweitrangig.
Gabriel versucht aber andererseits, »die Atomisierung von Arbeits- und Lebenswelten« nicht nur als Folge »falscher Politik« zu begreifen, sondern als eine mit den sich verändernden ökonomischen Voraussetzungen so eng wie widersprüchlich verwobene Entwicklung. Er wirft eine Frage auf, die auf die Grundlagen sozialdemokratischer Politik überhaupt zielt: »Fast alle Bedingungen für den sozialdemokratischen Erfolg in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts sind verschwunden.« Worauf aber gründet sozialdemokratische Politik dann heute?
Soziale Moderne, regressive Moderne
Auch hier liegt es nahe, an Nachtwey zu erinnern: »Wachstum bildete in der Vergangenheit die zentrale Ressource für eine Moderation struktureller Ungleichheiten, indem bei steigender Produktivität Beschäftigung und gesellschaftliche Integration durch sozialen Aufstieg ermöglicht wurden.«
Als der Motor nicht mehr so gut lief, etwa seit den 1970er Jahren, begann eine »Revolte des Kapitals« gegen die soziale und demokratische Einhegung des Kapitalismus. »Die komplexe institutionelle Regulierung des Nachkriegskapitalismus mit seinem dichten Netz von arbeitsrechtlichen und sozialstaatlichen Absicherungen, einem eingebetteten Finanzmarkt sowie umfassend staatlich gesteuerten Sektoren erschien der Unternehmerseite nun als ein ›zentrales Hindernis der Kapitalakkumulation‹«. Letztlich aber »konnten weder der Neoliberalismus noch die Finanzialisierung das Versiegen der Wachstumskräfte aufhalten«. Aber auch »der klassische keynesianische und fordistische Mechanismus der Stabilisierung der Nachfrage durch die Löhne funktionierte im Finanzkapitalismus nicht mehr«.
(Hier wäre über den Befund im ersten »Weltreport über Ungleichheit« nachzudenken, in dem der Anstieg der Ungleichheit seit dieser Zeit als »das Ende eines egalitären Nachkriegsregimes« bezeichnet wird – lassen sich die Voraussetzungen dafür einfach so wiederherstellen?)
Gabriel ist »der Überzeugung, dass die Krise der deutschen Sozialdemokratie weniger etwas mit einem Regierungsbündnis mit den Konservativen in Deutschland zu tun hat als mit diesen völlig veränderten Rahmenbedingungen für sozialdemokratische Politik«. Das ist ein anderer Ton als der übliche, in dem abgewogen wird, ob eine nächste GroKo für die SPD das letzte Stündlein schlagen wird oder etwas anderes oder ob man mit feschen Mitbestimmungsinstrumenten aus der Krise kommt. Gabriel verweist zumindest auf die zentrale, aber kaum besprochene Stelle – wenn man so will: die Politische Ökonomie sozialreformerischen Handelns. (Siehe dazu auch hier und hier.)
Kein Gramm utopischen Überschuss
Hier müsste Gabriels Text eigentlich erst so richtig einsteigen, weitergehen, vorausdenken, tut er aber nicht. Am Ende schlussfolgert Gabriel, es brauche eine »andere Aufstellung«, die vor allem auf »die Europäisierung und Internationalisierung unserer politischen Konzepte« gerichtet sein müsse. Was das konkret heißen könnte, steht dahin. Man wird noch andere Punkte für diskussionswürdig halten können, das ist klar. Die Sozialdemokratie, von der Gabriel hier spricht, hätte kein Gramm utopischen Überschuss mehr, sie will nicht mehr sein als soziale Reparaturbrigade des Kapitalismus, ihr fehlt die Lust an der Idee grundlegender Veränderung. Auch die Analyse ist, der Sozialdemokrat sagt es selbst, holzschnittartig.
Hinter Gabriels Gedanken wird man aber nicht zurückfallen können, wenn man die Krise des politischen Handelns in der sozialdemokratischen Matrix überwinden will. Thomas Sablowski von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat es einmal so formuliert: »Die neoliberale Wendung der Sozialdemokratie war aber nicht lediglich ein politischer Fehler, ein Irrtum, der einfach korrigiert werden könnte. Vielmehr war sie ein Resultat der Erkenntnis, dass die traditionellen sozialdemokratischen Positionen unter den Bedingungen freier Kapitalmobilität und verschärfter Weltmarktkonkurrenz nicht mehr aufrechterhalten werden können.«
Wie also können diese Positionen zurückerobert werden?
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode