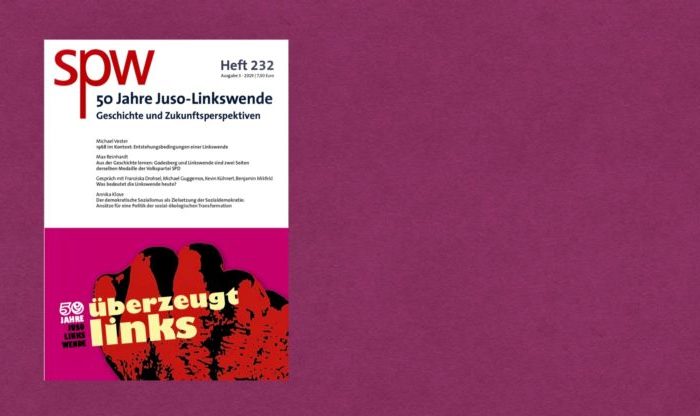Gefühlte Sozialdemokratie, wahrgenommene SPD und das »Vorbild« Dänemark
Kann die dänische Sozialdemokratie der SPD als Vorbild dienen? Das schließt mancher aus den Ergebnissen einer aktuellen Studie. Horst Kahrs hat sich die Ergebnisse einmal genauer angesehen.
Soll man die dänische Sozialdemokratie als Vorbild für politische Kursentscheidungen etwa der SPD nehmen? Politiker wie Sigmar Gabriel haben sich nach der Folketingswahl entsprechend geäußert, angeblich hätten die Socialdemokraterne von ihrer Mischung aus Einwanderungsabwehr und Sozialpolitik profitiert. Gegen solche Argumente wurde vielfach darauf hingewiesen, dass die dänische Sozialdemokratie erstens gar keine Stimmen hinzugewonnen hat, zweitens die Verluste der Rechtspopulisten eher zu Zugewinnen bei der Liberalen Partei führten und drittens die Zustimmung zu linksgrün-progressiven Parteien gewachsen sei, was mit der Rechtsverschiebung vor allem der Migrationspositionen der Socialdemokraterne erklärt wird. Kurzum: Von Anfang an hinterließen die Rufe nach einer »Dänisierung« der SPD den Eindruck, hier werde etwas zum Anlass für Argumente genommen, das man zu diesem Zweck erst einmal verbiegen muss.
Die Diskussion darüber ist inzwischen etwas leiser geworden, was auch damit zu tun haben dürfte, dass in der SPD-Spitze von einem »Vorbild Dänemark« nicht viele etwas wissen wollten. Man könnte nun lange darüber nachdenken, ob die SPD in der Großen Koalition nicht ohnehin schon eine in Migrationsfragen außerordentlich restriktive Politik mitträgt, die nicht recht zu den menschenrechtlichen Appellen ihrer Politiker passt. Auf eine inzwischen von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebene Studie von Jérémie Gagné und Richard Hilmer wurde indes hier und da abermals so reagiert, als könnten die Ergebnisse argumentativ für eine »Dänisierung« herangezogen werden.
»Betrachtet man die Ergebnisse der Studie, so erscheinen die dänischen Sozialdemokraten durchaus als Vorbild – nicht nur für die SPD, sondern für die ganze linke Mitte Europas: Sie gewinnen Wahlen, weil sie in vielen Fragen Positionen bezogen haben, die deutlich näher an den Erwartungen der Wähler sind als die anderer Mitte-Links-Parteien in Europa«, heißt es etwa im »Vorwärts«; im »Tagesspiegel« wurde das Ergebnis der Untersuchung so zusammengefasst: »Während die dänischen und britischen Sozialdemokraten im europäischen Vergleich laut Studie besonders nahe bei den Stimmungen und Erwartungen der Bevölkerung sind, trifft dies auf die SPD nicht zu.«
Inzwischen hat sich Horst Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Studie einmal genauer angesehen. Für diese waren in neun europäischen Ländern Daten erhoben und mit den üblichen Methoden ausgewertet worden: Großbritannien, Schweden, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Polen. »Zu erfassen versucht wurde, inwieweit die Parteien noch ihrem Anspruch gerecht wurden, sich als Mitte-Links- Parteien und ›Schutzmacht der kleinen Leute‹ zu profilieren. Das Ergebnis fiel für einige Länder, so die deutsche Sozialdemokratie durchaus niederschmetternd aus. Die Gründe für das Schrumpfen des Wählerpotentials bestehen danach in einer gewachsenen Kluft zwischen den sozial-, gesellschafts- und kulturkonservativen Erwartungen eines Teils früherer sozialdemokratischer Wählerschaften und dem wahrgenommenen Einsatz der Sozialdemokratie für Themen und Grundsätze, die diesen Schichten besonders wichtig sind«, fasst Horst Kahrs den Tenor zusammen.
Aber lässt sich daraus die Schlussfolgerung ziehen, eine »Dänisierung« der SPD sei erfolgversprechend oder politisch sinnvoll? Kahrs formuliert einige grundlegende Bedenken: Wenn eine empirische Untersuchung auf die Nähe der Partei zu den »Positionen des Bevölkerungsdurchschnitts« zugeschnitten wird, also nach der »Deckungsgleichheit mit dem Common Sense der Gesamtbevölkerung« fragt, werde unterstellt, dass »Common Sense« und »Durchschnitt« eine »gegebene Größe« seien und »deren Veränderbarkeit und Veränderung im Zeitverlauf grundlegender gesellschaftlicher Umwälzungen und unter Einwirkung politischer Akteure ausgeblendet«. Die Position der Sozialdemokratie erscheine »dann als gelungene oder misslungene Anpassung, nicht aber als die einer politischen Formation, die an der politischen Willensbildung mitwirkt«, so Kahrs.
Zwar seien dennoch »ausgewählte Erhebungsergebnisse nicht uninteressant für Diskussionen zur Zukunft linker Politik, zumal jene, die ehemalige sozial- demokratische Stammwähler und die ›sozial Schwächeren‹ betreffen«. Aber hierzu wird dann auch angemerkt, dass in der Studie »an keiner Stelle genauer dargelegt« werde, »wer zu letzteren zählt«. Die für die Studie erhobenen Antworten auf Fragen »nach den Sorgen schließlich verstellt eher den notwendigen spezifischen Blick auf diese Sorgen«. Und schließlich, so noch ein Beispiel aus den Anmerkungen von Kahrs, zeigten sich deutliche Diskrepanzen in den subjektiven Urteilen der Befragten über die Sozialdemokratie, die man nicht mit recht eindeutigen Politikempfehlungen überspielen sollte: Unter den Ärmeren sagten gut drei Viertel, es fiele ihnen »eher schwer« oder »sehr schwer«, die Ziele der SPD einzuschätzen – zugleich meinten in dieser sozialen Gruppe aber 60 Prozent zu wissen, dass sich die sozialdemokratische Partei derzeit »um Randthemen« statt »um richtige Themen« kümmere.
Das macht es freilich nicht weniger wichtig und sinnvoll, unterschiedliche Gesellschaftsbilder, die Lücke zwischen der »subjektiv erwarteten Sozialdemokratie« und dem wahrgenommen Bild der Politik zum Beispiel der SPD genauer anzuschauen. In der Studie heißt es hierzu, »die Entfremdung zwischen Sozialdemokratie und sozial schwächeren Wahlberechtigten findet also zeitgleich auf kultureller und klassischer materieller Links-Rechts-Konfliktachse statt. (…) Insgesamt muss also geschlossen werden, dass zwischen unterprivilegierten Wahlberechtigten und der deutschen Sozialdemokratie nur wenige programmatische Kontakt- und Anknüpfungspunkte vorhanden sind.« Und weiter: »Ein großer Teil der ehemaligen SPD-Wählerschaft positioniert sich deutlich gegen eine weitergehende Öffnung der Gesellschaft zugunsten von Einwanderung und Multikulturalität. Dabei ergibt sich die Kluft zwischen Partei und Bürger_innen anteilsmäßig weniger aus der gemäßigt libertären SPD-Position als vielmehr aus der markant restriktiven Policy-Position der Befragten selbst. Gerade vor dem Hintergrund wachsenden Rechtspopulismus ist interessant, dass es der SPD – anders als noch in den letzten Jahrzehnten – offenbar nicht mehr gelingt, derart kulturkonservative Wählerkreise an sich zu binden, beispielsweise über attraktive Angebote in anderen Bereichen.«
Kahrs fasst seine Lektüre der FES-Studie so zusammen: »Die Abwendung von der SPD erfolgt generell wie auch besonders bei sozial Schwächeren mit ›sozialkonservativen‹ und ›kulturkonservativen‹ Motiven. Entscheidend dabei sind nicht allein bzw. so sehr die Positionierungen in den einzelnen Politikfeldern, sondern die wahrgenommene Differenz zwischen dem eigenen Normengerüst bzw. Gesellschaftsbild und dem wahrgenommenen Einsatz der SPD für diese Grundsätze. Damit ging ein zentrales Vertrauen stiftendes Bindeglied verloren: die Gewissheit, dass die Partei in ihrem konkreten Handeln Grundsätzen folgen würde, die einem selbst wichtig sind. Dieses zerrüttete Vertrauensverhältnis wird sich schwerlich wieder reparieren lassen. Zudem setzen sich die dynamischen Prozesse: vor allem Transnationalisierung der Wertschöpfungsketten und Umwälzung der Arbeitswelt fort, die es der Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland so schwer machen, die konservativen Schichten ihres Wählerpotentials weiterhin zu binden – ohne sich auf ›Volk‹ und ›Re-Nationalisierung‹ zu berufen. Vielmehr ist zu erwarten, dass sich soziale und berufliche Deklassierungen infolge des technischen Wandels, der neuen Urbanisierungswelle und der Ausweitung transnationaler (Teil-)Arbeitsmärkte fortsetzen werden, ohne dass es gelingen wird, diese Umwälzung mit einer Wiederherstellung der abfedernder Sicherheiten des fordistischen Wohlfahrtsstaates zu begleiten. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten individuellen sozialen Aufstiegs (national) begrenzt. Parteien links von der Sozialdemokratie ist es in Nord- und Westeuropa für einen begrenzten Zeitraum gelungen, enttäuschte sozialdemokratische Wähler für sich zu gewinnen. Sie konnten indes auch keine neue Vertrauensbeziehung aufbauen, weil sie weder die Wiederherstellung der ›alten/bedrohten Ordnung‹ noch ihre Erneuerung unter veränderten Bedingungen glaubhaft machen konnten. Es geht dabei eben nicht um einzelne Politikfelder, sondern um die ›gefühlte‹ Übereinstimmung zwischen dem, was einem selbst wichtig ist und was der Partei wichtig ist. Gegen dieses eher düstere Fazit sind selbstverständlich Einwände möglich. Ein solch berechtigter Einwand lautet, dass die Urteile über die SPD nur in Relation zu den Urteilen über andere Parteien zu bewerten sind. Die hohe Volatilität im Wahlverhalten spricht dafür, dass die Differenzen zwischen eigenen Einstellungen und dem wahrgenommenen Profil auch für (die) andere(n) Parteien festzustellen wären, und Wahlentscheidungen unter eher taktischen Erwägungen und kurzfristigen Stimmungslagen erfolgen.«
Die kompletten »Informationen zu einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung« von Kahrs unter dem Titel »Sozialdemokratischer Sinkflug unaufhaltsam?« gibt es hier als PDF.
Foto: AOP / CC BY-SA 4.0
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode