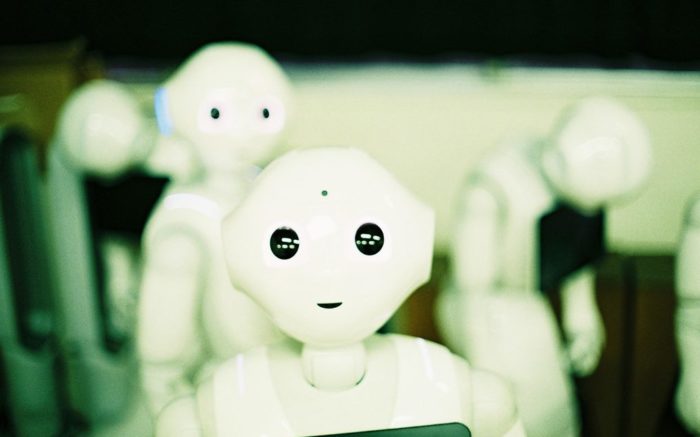Industrie 4.0, ein Weg aus der Stagnation?

Steigt mit dem »neuen Maschinenzeitalter« die Produktivität der Volkswirtschaft, die seit Jahren nahezu stagniert? Und führt die Digitalisierung zu neuen Investitionen?
Die Debatte über die Folgen von Industrie 4.0, weiter gefasst als Arbeit oder Wirtschaft 4.0, wird seit Jahren sehr breit, sehr differenziert und mit großen Widersprüchen geführt. Sabine Pfeiffer hat wichtige Aspekte bereits kritisch beleuchtet. In diesem Text geht es um die entscheidende Frage: Welche Wirkungen haben solche Wellen technischer Innovationen, wie sie mit der Formel vom »neuen Maschinenzeitalter« skizziert werden, auf die volkswirtschaftliche Produktivität einer Gesellschaft?
Allgemein wird angenommen, dass die umfassende Digitalisierung der Gesellschaft sich in einer steigenden gesamtwirtschaftlichen Produktivität oder mindestens in einer steigenden Produktivität des industriellen Sektors zeigen müsste. Die vorliegenden Studien sagen dazu nichts aus, da sie in erster Linie darüber spekulieren, was technisch möglich wird, welche Qualifikationen eventuell entwertet werden und wie die Folgen auf dem Arbeitsmarkt sein werden.
Trügerische Hoffnungen wegen Industrie 4.0
Dabei ist es eine Banalität, dass die Investitionen, mit denen die neuen Arbeitsmethoden und die neuen Maschinen finanziert werden, sich in einer kapitalistischen Gesellschaft rechnen müssen; sie müssen im Verhältnis zum Einsatz von Arbeitskräften profitabler sein, sonst unterbleiben sie. Sicher kann mit besseren Maschinen und rationelleren Arbeitsverfahren mehr produziert werden – aber einen Wert haben diese zusätzlich hergestellten Produkte und Dienstleistungen nur, wenn sie auch bezahlt, also verkauft werden.
Zu dem empirisch feststellbaren Zusammenhang von Innovationen, Investitionen und gesamtwirtschaftlicher Produktivität wird geforscht. Aber die Ergebnisse sind anders, als die aktuelle Debatte über die Effekte von Wirtschaft 4.0 vermuten lassen: Trotz umfassender technischer Innovationen seit dem Einsatz und der Ausweitung der Mikroelektronik vor Jahrzehnten verlangsamt sich das Wachstum der Produktivität. Es ist in den vergangenen 15 Jahren sogar so gering geworden, dass eine Reihe von Ökonomen von einer säkularen, also von einer langfristigen Stagnation des gegenwärtigen Kapitalismus sprechen. Dieses Resultat wird in der volkswirtschaftlichen Diskussion als »Produktivitätsparadox« oder – nach dem amerikanischen Ökonomen Robert Solow – als »Solow-Paradox« bezeichnet. Danach beeinflussen sogar große technische Innovationen die Produktivität der reifen kapitalistischen Gesellschaften nicht mehr oder nur unwesentlich.
Dieser zentrale Aspekt spielt jedoch in den vielen und durchaus kontroversen Debatten über die Effekte der Wirtschaft 4.0 keine Rolle – die Debatten finden also quasi in einem ökonomiefreien Raum statt. Sie sind vor allem von der Frage geprägt, was ist technisch möglich. Aber niemand fragt nach den Bedingungen, unter denen das neue technisch Mögliche ökonomisch auch verwirklicht werden kann. Über diese entscheidende Frage gibt es zwar kritische wirtschaftswissenschaftliche Diskurse. Aber diese werden von den Akteuren der Debatte über Digitalisierung und Industrie 4.0 viel zu wenig wahrgenommen.
Produktivitätszuwachs schrumpft: erst 7 Prozent, dann 3, dann …
Wenn wir die Daten der Produktivitätsentwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft – also die Größe von Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Verhältnis zur Zahl der Erwerbstätigenstunden –, anschauen, so sehen wir: Die Produktivität stieg lediglich im Zeitraum von 1951 bis 1975 stark an; in den 1950er Jahren um durchschnittlich gut sieben Prozent, in den 1960ern um 6,1 Prozent und dann im Zeitraum von 1968 bis 1975 noch um 5,2 Prozent. Dann folgt ein kleiner Absturz: In den 1980er Jahren wuchs die Produktivität der Gesamtwirtschaft gerade noch um drei Prozent. Es wird gelegentlich die Meinung vertreten, ausschlaggebend sei die Entwicklung der Produktivität im Verarbeitenden Gewerbe. Aber auch hier liegen die Raten nur gering über den gesamtwirtschaftlichen Größen und gehen ebenso wie diese spürbar zurück.
Die 1980er-Jahre, als die Folgen der sogenannten dritten industriellen Revolution – konkret die Einführung der Mikroelektronik in die industrielle Produktion – gespürt wurden, waren geprägt von Diskussionen über Chips & Jobs, technologische Arbeitslosigkeit, von Debatten über ein Ende der Arbeitsgesellschaft und, wie auch heute wieder, über die Notwendigkeit eines garantierten Grundeinkommens. Obwohl damals flächendeckend neue Techniken eingeführt wurden: Weder in der Gesamtwirtschaft noch in der Industrie belebte sich das Wachstum der Arbeitsproduktivität. Im Gegenteil schwächte es sich weiter spürbar ab.
… noch weniger bis heute: auf schlappe 0,5 Prozent
Zu Beginn der 1980er-Jahre stieg die Arbeitslosigkeit. Das war aber keine Folge steigender Arbeitsproduktivität. Vielmehr führte die erhöhte Arbeitslosigkeit zu einer Unterauslastung der Kapazitäten, und diese führte zu einer noch stärkeren Abflachung des Produktivitätswachstums. So bestimmten konjunkturelle Schwankungen sehr viel stärker die Entwicklung der Produktivität als technologische Veränderungen.
Lediglich in den Jahren 1990/91 stieg das Wachstum der Produktivität wieder auf 3,5 Prozent an. Aber auch das hatte nichts mit technischen Innovationen zu tun, sondern mit der Auslastung aller Kapazitäten wegen des damaligen Vereinigungsbooms. Entsprechend fiel danach in den 1990er Jahren das Wachstum der Arbeitsproduktivität erneut und pendelt über viele Jahre hinweg zwischen 1,2 und 2,5 Prozent. Maßgebend für diese Schwankungen im Produktivitätstempo war dabei immer die Entwicklung der Konjunktur. Ein Einfluss von technologischen Faktoren war nie feststellbar. Der Trend hat sich in den 2000er Jahren fortgesetzt: Das Produktivitätswachstum ging weiter zurück und pendelte meist zwischen einem und zwei Prozent. Einen Minusrekord gab es im Krisenjahr 2009: minus 2,6 Prozent.
Ob USA oder EU: weit und breit kein Produktivitätsschub
Danach stieg die Produktivitätsrate für zwei Jahre auf gut zwei Prozent, um sich nach 2011 bei rund 0,5 Prozent einzupendeln. Von einem Produktivitätsschub ist also weit und breit keine Spur. Diese Ergebnisse gelten im Großen und Ganzen auch für die anderen »reifen« kapitalistischen Gesellschaften. Die USA konnten Mitte der 1990er-Jahre zwar ein kleines Produktivitätswunder verzeichnen, dieses wurde aber auch aufgrund der speziellen amerikanischen Messung des Inflationsniveaus – es wird zu niedrig ausgewiesen – verstärkt.
So steht fest: Diesen erwarteten oder befürchteten direkten Zusammenhang zwischen der breiten Anwendung technischer Innovationen und der positiven Entwicklung der Produktivität gibt es nicht. Zumindest in den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist er nicht nachweisbar.
Einen direkten Zusammenhang zwischen der Anwendung neuer Technologien und der Entwicklung der Produktivität gibt es nicht.
Tweet this
Dagegen wird eingewandt, dass die Digitalisierung als »vierte industrielle Revolution« so mächtig ist und so mächtig noch wirken wird, dass es in den Jahren 2017 bis 2030 doch noch zu einem signifikanten Produktivitätswachstum kommen werde; die Umsetzung von Innovationen in höhere Produktivität brauche eben viele Jahre. Für diese These spricht allerdings aus einer makroökonomischen Sicht: nichts.
Denn seit vielen Jahren gehen nicht nur die öffentlichen, sondern auch die privaten Investitionen zurück. Wenn die finanziellen Beziehungen – also die Salden von monetären Zuflüssen und Abflüssen – zwischen den fünf Sektoren der Gesamtwirtschaft (finanzielle und nichtfinanzielle Unternehmen, Privathaushalte, Staat und Ausland, der Sektor der nichtfinanziellen Unternehmen, der Sektor der Privathaushalte) betrachtet werden, dann gilt für Deutschland: Die Sektoren der nichtfinanziellen Unternehmen und die Privathaushalte haben deutliche Nettofinanzierungsüberschüsse aufgebaut, während die anderen Sektoren verschuldet sind.
Alle schwimmen im Geld, niemand investiert
Privathaushalte und nichtfinanzielle Unternehmen »schwimmen« also im Geld. Aber die nichtfinanziellen Unternehmen – die sogenannte Realwirtschaft – investieren trotz der positiven Entwicklung ihrer Gewinne wenig. Verschuldet sind dagegen der Staat, die finanziellen Unternehmen und das Ausland. Der chronische Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands zeigt, dass in großem Umfang Kapital exportiert wird, weil für kräftige Binneninvestitionen die Nachfrage in Deutschland selbst zu schwach ist.
Diese Ergebnisse der sogenannten Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) sind völlig unstrittig. Neoklassische ÖkonomInnen neigen jedoch dazu, sich mit solchen makroökonomischen Fragen nicht zu beschäftigen. Gestritten wird über die Frage: Mit welchen Maßnahmen kann die schwache Investitionsentwicklung wieder angeschoben werden? Die KeynesianerInnen weisen darauf hin, dass die enorm gestiegene Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen und die Sparpolitik der Staaten die effektive Nachfrage spürbar verringert haben. Dagegen setzen die neoklassischen ÖkonomInnen auf die alten Methoden: die Märkte weiter deregulieren, Steuern und Löhne senken, um so den Anreiz für zusätzliche Investitionen bei den privaten Unternehmen zu stärken.
Enttäuschte Neoklassiker
Die NeoklassikerInnen können auch nicht anders, denn die Seite der Nachfrage in einer Gesellschaft kommt in ihren Modellen nicht vor. Weil sie nur angebotsorientiert denken, versprechen sie sich von der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitsprozesse sinkende Kapital- und Arbeitskosten. Sie müssen jedoch, zusammen mit dem Sachverständigenrat in seinem aktuellen Jahresgutachten 2015, resigniert feststellen, dass der Zusammenhang zwischen Digitalisierung und steigender Produktivität gar nicht vorhanden oder zumindest viel komplizierter ist, als von ihnen bisher angenommen.
Warum erzeugt diese vierte industrielle Revolution in der Öffentlichkeit so viel Wirbel und bei den Gewerkschaften so große Ängste vor einer technologischen Arbeitslosigkeit? Der Grund: Die kapitalistische Ökonomie wird überwiegend von der praktischen Produktion her gedacht. Aus dieser Perspektive sieht die Welt so aus: Wenn es technische Verbesserungen in großem Stil gibt, dann muss die Produktion stark steigen und auch die Produktivität.
Was man aus der Geschichte lernen kann
Dabei kann aus der Geschichte gelernt werden, dass dies so nicht funktioniert: In keiner der Phasen großer technologischer Umwälzungen, also auch nicht während der vorhergehenden drei industriellen Revolutionen, war dieser positive Zusammenhang zu sehen. Das Wachstum des BIP pro Kopf und damit auch das Produktivitätswachstum pro Erwerbstätigenstunde waren in den großen kapitalistischen Ländern nur in dem Zeitabschnitt zwischen 1950 und 1973 überdurchschnittlich hoch. Damals machten die makroökonomischen Rahmenbedingungen ein hohes Wachstum von Produktion und Produktivität möglich. Zwischen 1974 und 2001 ging dieses Wachstum, wie wir gesehen haben, deutlich zurück und sank nach 2001 weiter – mit Ausnahme der früher staatssozialistischen Ökonomien und der industriellen Schwellenländer. Der Grund: Beide Ländergruppen befanden und befinden sich in einem Prozess der nachholenden industriellen Entwicklung.
Mageres Wachstum wie in den Zeiten vor 1950
Nur wegen dieser Nachholprozesse in Osteuropa und in den Schwellenländern steigt das Weltsozialprodukt insgesamt noch mit einer Rate von 2,5 bis 3,5 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA und Westeuropa wächst jeweils viel geringer. Das legt den Schluss nahe, dass das Wachstum von BIP und Produktivität nicht von den Angeboten der Wirtschaft her getrieben ist, sondern von der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Wegen der zunehmenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen und verstärkt von einer rigiden Sparpolitik ist jedoch die effektive Nachfrage in den »alten« Industriegesellschaften, die so dringend benötigt würde, zurückgeblieben; die Nachfrage definiert als die Summe aus privater und öffentlicher Nachfrage und ins Verhältnis gesetzt zum Produktionspotenzial.
Die Wachstumsraten nähern sich hier inzwischen wieder einer Größenordnung an, wie sie vor 1950 vorherrschend war: zwischen 0,5 und 2 Prozent. Auch wenn Gesellschaften mit einer strikt exportorientierten Wirtschaftspolitik versuchen, sich im internationalen Wettbewerb Vorteile zu verschaffen, wie das Deutschland seit 1951 mit Erfolg durchgesetzt hat, so muss beachtet werden: Diese Strategie funktioniert nur, wenn andere Länder verlässlich Güter und Dienstleistungen nachfragen und wenn diese Länder auch immer in der Lage sind, diese Nachfrage zu finanzieren. Die Konsequenz daraus: Technologische Entwicklungen sind immer in einen bestimmten makroökonomischen Rahmen eingebunden. Und es sind diese makroökonomischen Bedingungen und Größen, die darüber entscheiden, ob und wie sich technische Veränderungen auf Produktivität und Wachstum auswirken. Aus dieser Sicht spricht nichts dafür, dass wegen Digitalisierung und Industrie 4.0 die Produktivität steigen wird. Weder in der Gesamtwirtschaft noch in der Industrie.
Führt die Digitalisierung zu zusätzlichen Investitionen?
Im Zusammenhang mit der Wirtschaft 4.0 bleibt noch eine spannende Frage: Führt die Digitalisierung zu zusätzlichen Investitionen? Aber: Warum sollte das der Fall sein? Denn wir sind ja, wie oben festgestellt, ebenfalls mit einer sinkenden Investitionsquote konfrontiert. Das heißt: In den Debatten über Wirtschaft und Industrie 4.0 wird viel Lärm um wenig gemacht. Schärfer formuliert: Dieser Hype basiert allein auf einem riesengroßen Missverständnis, nämlich der Ansicht, dass technische Innovationen quasi automatisch zu mehr Investitionen und zu höherer Produktivität führen. Die unbestrittene Erkenntnis aus der Geschichte, dass technische Innovationen allein die Produktivität einer Gesellschaft noch nie messbar erhöhten, wird fahrlässig ignoriert. Der große Jubel oder das große Erschrecken wegen Wirtschaft 4.0 – für beides gibt es keinen Grund.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode