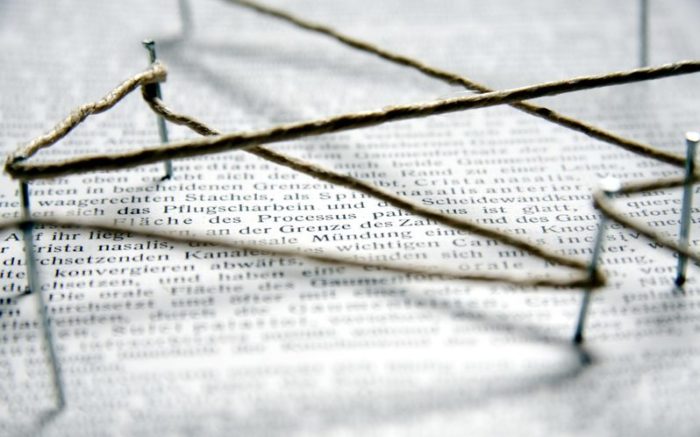»Moral Economy« – ein anderer Blick auf ›Wirtschaft‹
Das Recht auf Subsistenz ist ein grundlegender Pfeiler der »moralischen Ökonomie«: Ein heute geradezu revolutionärer Gedanke. Aus OXI 4/23.
»Es fällt uns nicht leicht«, schrieb Edward P. Thompson (1924-1993), »uns vorzustellen, daß es in einem kleineren und in sich geschlossenen Gemeinwesen eine Zeit gegeben haben mag, in der es unnatürlich schien, daß irgend jemand aus der Not der anderen Profit zog, und in der angenommen wurde, daß die Preise der lebenswichtigen Güter in Perioden der Teuerung auf einem gewohnten Niveau bleiben sollten, auch wenn es überall weniger geben mochte.« Sein Aufsatz von 1971 bezog sich auf »Die ›moralische Ökonomie‹ der englischen Unterschichten im 18. Jahrhundert« und damit auf die Umbrüche im Übergang zu einer Marktgesellschaft – also einen Zeitraum, den Polanyi einst als große Transformation beschrieb. Tatsächlich mag es heute im Jahr 2023, in einer fast schon durchökonomisierten Welt und unter dem Eindruck der Dominanz eines mainstream-ökonomischen Denkens, befremdlich wirken und irritieren, darauf hingewiesen zu werden, dass Menschen nicht wie Automaten allein auf rein ökonomische Anreize reagieren, sondern sich in ihrem Handeln (auch) an Normen des guten und richtigen Lebensorientieren mögen. Ökonomisches Handeln, dass (auch) um Legitimationsvorstellungen kreist? Genau das ist der Kern dessen, was fachlich als »moral economy« bezeichnet wird und kritisch ›dem‹ Modell einer neuen politischen Ökonomik (globale Marktwirtschaft) gegenübergestellt werden mag. Thompson interessierte sich in seinem Aufsatz für den kollektiven Widerstand – Brotaufstände usw. – im England des 18. Jahrhunderts, der sich gegen als unbotmäßig hoch empfundene Preise für Lebensmittel und Getreide, gegen das Zurückhalten von sowie die Spekulation mit Getreide oder gegen das Strecken von Mehl (durch Beimengungen wie Knochenmehl) richtete. Er schilderte, wie in älteren Gesellschaftsordnungen ›der‹ Markt als physischer Markt tatsächlich der Verteilung u. a. lebenswichtiger Güter diente. Dazu war dieser Markt auf eine Weise reguliert, die die Bedürftigen bevorzugte, indem ihnen ermöglicht wurde, notwendige Güter (Getreide usw.) zu erschwinglichen Preisen tauschen zu können. Das geschah zum Beispiel mittels Preisfestsetzungen und darüber, dass als Erstes arme Menschen Zugang zum Markt hatten und lizensierte Händler erst zu einem späteren Zeitpunkt ihre Geschäfte tätigen durften. Darin zeigte sich eine gewisse sozial verantwortliche Seite, die sich an der Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse der Ärmsten orientierte.
Dieser Gedanke führt geradewegs zum amerikanischen Politikwissenschaftler und Anthropologen James C. Scott (*1936), der 1976 in seinem Buch »The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia« über Subsistenz – Selbsterhaltung – und ein »right to subsistence« (als Moralprinzip) nachdachte. Der dort im Titel erwähnte Begriff der »moral economy« deutet bereits an, dass für Scott das wirtschaftliche Handeln von einem Geflecht moralischer Regeln getragen wird. Wesentlich seien dabei zwei moralische Prinzipien: erstens das der Reziprozität und zweitens ein »right to subsistence«.
Unter »Subsistenz« verstand Scott die Fähigkeit, sich physisch am Leben halten zu können und dabei angemessen als Mitglied der Gesellschaft an der Gesellschaft teilzuhaben. Dies umfasst die Fähigkeit, sich selbst helfen zu können. Als Orientierung dient die Vorstellung eines Einkommens, das Ersparnisse zulässt. Das eben erwähnte »right to subsistence« bezeichnet dann den Anspruch eines jeden Menschen auf die Güter, die eine soziokulturelle Existenz ermöglichen. Unverkennbar steht damit das Motiv der Selbsterhaltung – Subsistenz – als handlungsleitend im Zentrum. Und daraus leiten sich dann verschiedene Fachbegriffe und Konzepte ab, die Scott mit seinem Buch einführte.
Dazu gehört zum Beispiel der Begriff der »Subsistenzethik« (subsistence ethics): Damit soll jenen Handlungen und Regeln der Vorzug gegeben werden, die Nahrungsmittelengpässe vermeiden und auf stabile Erträge abzielen. Spezifiziert wird dies durch ein »safety first principle«, das darauf abstellt, direkte Subsistenzgüter (Nahrungsmittel) anzubauen und Saatgüter sowie Agrartechniken zu verwenden, die die Gefahr von Missernten reduzieren. Das schließt eine marktwirtschaftliche Betätigung ausdrücklich nicht aus, setzt aber klare Prioritäten: Erst dann, wenn alle für das Lebensnotwendige erforderlichen Tätigkeiten erledigt sind, können Güter für ›den‹ ›Markt‹ produziert werden. Sinn und Zweck ist, neben natürlichen Gefahren von Missernten auch subsistenzbedrohliche Marktrisiken zu vermeiden.
Als »minimum disaster level« ist bei Scott ein Einkommensniveau bezeichnet, auf dem sich die physische Existenz gerade so befriedigen lässt. Fällt das Einkommen unter diese Grenze, drohen Mangelernährung und frühzeitiger Tod. In der Zone der Subsistenzkrise (subsistence crisis zone) wird gewirtschaftet, wenn es nicht mehr möglich ist, zu sparen. Die Betroffenen leben dann sprichwörtlich von ihrer Substanz. Bei den von Scott untersuchten südostasiatischen Agrarhaushalten schlug sich das zum Beispiel darin nieder, Kinder zu Verwandten zu schicken oder Landstücke und Tiere zu verkaufen. In dieser Situation sind die Haushalte mit höherer Unsicherheit, einem geringeren Sozialstatus und einem geringeren Familienzusammenhalt betroffen. Das erwähnte »safety first«-Prinzip sei charakteristisch für das Wirtschaften in der Zone der Subsistenzkrise.
Angesichts einer Notlage wird zunächst das erwähnte moralische Prinzip der »Reziprozität« greifen. »Reziprozität« bezieht sich dabei auf soziale Arrangements der Gegenseitigkeit, wo aus einer Gabe die Verpflichtung zur späteren Gegengabe resultiert. Insbesondere in Notzeiten gilt eine Pflicht zur Unterstützung und, dass jene, denen geholfen wird, anderen in Notzeiten ebenfalls helfen. Scott unterschied dabei eine balancierte (symmetrische) Reziprozität, bei der gleichwertige Dinge gegeben werden. Wer einen Sack Reis in der Not erhält, gibt nach überwundener Not einen Sack Reis zurück. Allerdings sind Reziprozitäts-Beziehungen nicht immer balanciert, sondern asymmetrisch. Das tritt vor allem bei Unterschieden in sozialen Gruppen auf wie zum Beispiel zwischen einer Patronin und ihren Gefolgsleuten. In diesen Fällen gleicht eine Reziprozitäts-Beziehung nicht einem Tausch gleichwertiger Objekte. Gleichwohl bleibt es eine moralisch verpflichtende Reziprozitätsbeziehung: Schutzherrinnen sind zur Hilfe in der Not verpflichtet und dies wird von den Gefolgsleuten auch erwartet, die Gefolgsleute wiederum verpflichten sich zur Loyalität und zur Verfügungstellung der Arbeitskraft. Scott macht vor diesem Hintergrund auf einen wichtigen Punkt aufmerksam: Solche Reziprozitäts-Verhältnisse müssen keineswegs »gerechte« Beziehungen sein, sondern können ungerechte Behandlungen und Ausbeutung beinhalten.
Solche asymmetrischen Sozialbeziehungen mögen als »ungerecht« empfunden werden und Unmut wecken, führen nach Scott aber nicht zwangsläufig zu Unruhen und Revolten. Revolten sind schließlich auch mit Risiken verbunden. Insbesondere staatliche Repression und Reaktionen können diesbezüglich abschreckend wirken. Revolten würden erst dann drohen, wenn die Selbsterhaltung – und damit: ein »right to subsistence« – ernsthaft bedroht sei. Allerdings gießt Scott auch dazu reichlich Wasser in den Wein: Denn solche Revolten erscheinen oft wenig progressiv, sondern – im Gegenteil – eher »rückwärtsgewandt«, da sie häufig auf die Rückkehr zu einer (traditionellen) weniger »ungerecht« empfundenen Gesellschaftsordnung abzielen. Angesichts der Drohung staatlicher Repression und unter dem Eindruck geringer Erfolgsaussichten können Revolten auch von Hoffnungslosigkeit sowie Fatalismus geprägt sein und damit gewaltsame Formen annehmen.
Diese Skizze soll genügen, um zu illustrieren, dass der Mensch eben nicht einfach ein Anreiz-Automat ist, wie es in der heutigen (Mainstream-) Ökonomik oft angenommen wird. Menschen bewegen sich auch beim Wirtschaften in einem Geflecht sozialer Normen und streben selbstverständlich – und vor allem – nach Leben, Existenz bzw. Selbsterhaltung, was die Vielschichtigkeit der damit verbundenen sozialen Arrangements und Sozialphänomene bedingt.
Darin liegt auch die Antwort auf eine kritische Frage, die hier am Ende vielleicht aufkommen mag: Warum soll die Beschäftigung mit der »moral economy« – die sich mit Schwerpunkt auf die englische Unterschicht im 18. Jahrhundert (Thompson) und auf südostasiatische Agrarhaushalte (Scott) konzentrierte – auch heute noch relevant sein?
Die Nahrungsmittel-Krisen, die in Folge der Klimaveränderungen, aber auch als Konsequenz westlicher Sanktionsregime im Kontext des Krieges gegen die Ukraine in verschiedenen Teilen der Welt drohen, rücken die Versorgung mit Lebensmitteln sehr nachhaltig in den Fokus der Öffentlichkeit und Wissenschaft. Mit dem Krieg gegen die Ukraine und den Sanktionen verbunden sind auch hohe Energie-Preise, mit denen Menschen in westlichen Industrieländern konfrontiert werden. Die davon angestoßenen Debatten über Preisregulierungen im Bereich Energie – Stichwort: Gaspreisdeckel – liegen dann tatsächlich nicht sehr weit entfernt vom Anliegen einer »moral economy«, wie sie Thompson einst thematisierte. Aber ebenso deutet die Empörung über Profite bzw. »Übergewinne« in Zeiten von Krisen (Krieg, Pandemie) auf Reste einer »moral economy« hin. Es existieren damit also sehr gute Gründe dafür, sich auch heute noch – in globalisierten Marktgesellschaften – den wirtschaftlichen Phänomenen aus Sicht einer »moral economy« zu nähern. Und in der Tat legen es die Ausführungen von James C. Scott nahe, die dort ausgebreiteten Erkenntnisse auf moderne Industrie- und Marktgesellschaften anzuwenden, insbesondere mit Blick auf Arbeitsbeziehungen.
Allerdings ist dieses Vorhaben mit nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten in der Wissenschaft konfrontiert. So wirkt es geradezu grotesk, dass ›die‹ (Mainstream-) Ökonomik die Existenzsicherung als Wirtschaftsmotiv nicht angemessen zu würdigen versteht und vor allem von Scott bislang keine Notz genommen zu haben scheint. Es steht zu befürchten, dass die moderne Mainstreamökonomik und auch heterodoxe Modellökonomiken mit einer »moral economy« wenig anzufangen wissen. Im schlimmsten Falle droht eine »moral economy« so gründlich missverstanden zu werden, dass am Ende wenig von ihrer eigentlichen Substanz übrigbleibt. Anders sähe es aus der Perspektive ›der‹ Wirtschaftsethik und vor allem einer echten Sozialökonomik – die Wirtschaft und Gesellschaft sozialwissenschaftlich zusammendenkt – aus. Dort wären fachlich die Voraussetzungen gegeben, um sich angemessen mit einer »moral economy« zu befassen und diese Perspektive einzunehmen. Aber das scheint unter der Dominanz einer modernen Mainstreamökonomik, die andere Sichtweisen ausgrenzt, noch in der Ferne zu liegen. Andererseits, vielleicht bietet die gerade »moral economy« im Kontext der erwähnten aktuellen Probleme auch einen guten fachlichen Anlass, um in diesem Sinne mehr Plurale Ökonomik zu wagen?
Weitere Texte zum Thema finden sich auf dem Blog von Sebastian Thieme.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode