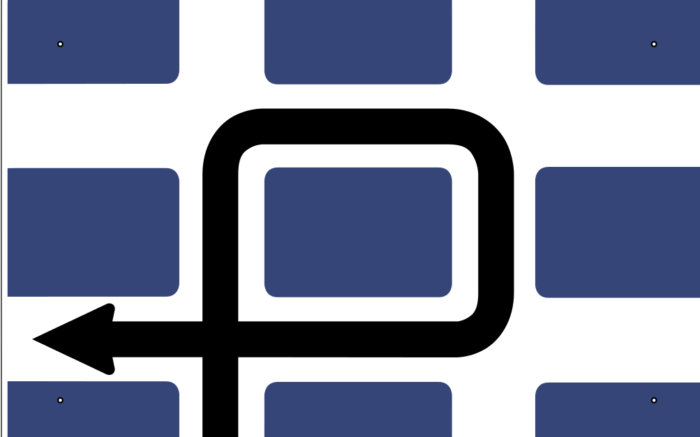#Nomaica: Warum man der FDP dankbar für das Platzenlassen der Sondierung sein könnte
 Foto: Punktional, gemeinfrei
Foto: Punktional, gemeinfreiDie FDP lässt die Sondierung platzen. Und das ist gut so. Kein Grund, von einer »Staatskrise« zu reden. Mit dem Scheitern könnten immerhin die richtigen Fragen ins Zentrum rücken. Nur: Werden die auch beantwortet?
Es wird nach dieser Nacht des Scheiterns der Sondierung erzählt, der FDP-Vorsitzende habe seine Entscheidung gegenüber Angela Merkel »von einem Zettel vorgelesen«, worauf die Kanzlerin gegenüber Christian Lindner erklärt haben soll, dies klinge wie eine vorbereitete Presseerklärung. »Mannomannomann«, um es mit einem führenden Kommunikator aus der SPD-Zentrale zu sagen.
Dazu lassen sich Berichte aus den vergangenen Tagen addieren, aus denen man erfuhr, wie die Freidemokraten »mehr als einmal mit überraschenden Manövern versucht« haben sollen, »Kompromissmöglichkeiten« zu erschweren. Und schließlich der Morgen danach, der zeigt, wie groß die Schwierigkeiten der FDP sind, ein bisschen eigene Interpretationshoheit über das Platzenlassen der Gespräche zu ergattern, weil man schlicht und einfach keinen springenden inhaltlichen Punkte für den Abgang nennen kann.
Kurzum, die vorherrschende Erzählung lautet: Die FDP hat die Sondierung vergeigt. Schon ist von »Staatskrise« die Rede. Der bis-eben-noch-Superstar Lindner scheint sich im freien Fall zu befinden; und in der »Welt« versucht man, eine Barrikade gegen einen angeblichen grünen Medienmainstream zu errichten. Versuchen wir doch mal, die Geschichte ein bisschen anders zu denken.
Aus falschen Gründen etwas Richtiges getan
Erstens: Die Freidemokraten haben aus falschen Gründen etwas Richtiges getan – eine Koalition verhindert, die zwar unter anderem ein naheliegender Ausdruck einer politischen Repräsentationskrise gewesen wäre, der man aber nicht schon deshalb Gelingen wünschen wird, weil es sonst keine Alternativen gibt. Dass die FDP nicht einer Logik der Unterordnung unter »staatspolitische Verantwortung« folgte, kann man ihr schlecht vorwerfen: Mit Phrasen vom Land, das immer vor der Partei kommen müsse, ist hier noch jeder schlechte Kompromiss begründet worden. So wurden Parteien und ihre Wähler diszipliniert, demokratiepolitisch hat das Spuren hinterlassen, wer über Frustwähler und Abwendung vom parteipolitisch-parlamentarischen Betrieb reden will, kann von der Phrase der »staatspolitischen Verantwortung« nicht schweigen.
Zweitens: Der Punkt ist doch weniger, dass die FDP die Gespräche hat platzen lassen – sondern, dass die Grünen es nicht schon vorher getan haben. Während die Freidemokraten aus taktischen Erwägungen heraus handeln (womöglich sind es die Erwägungen eines Einzelnen), und sich nun nachträglich mühsam inhaltliche Gründe zurechtlegen müssen, hätten die Grünen mehr als einen inhaltlichen Grund gehabt, von sich aus die Reißleine zu ziehen – auch auf die Gefahr hin, dass sich dies taktisch nicht ausgezahlt hätte. So steht nun ausgerechnet die FDP als Partei mit »Haltung« da, selbst wenn man diese eine kritikwürdige nennen möchte. Ein Kollege meinte ganz zu Recht, dass nun zwar »das Kommentariat« den Freidemokraten ihren Schritt nachtragen wird, aber dass dies auch unter den Wählern die vorherrschende Meinung sein wird, darf man bezweifeln. Und die Grünen dürften froh sein, dass bald niemand mehr von »atmenden Obergrenzen » spricht.
Das große Bild etwas schärfer sehen
Drittens: Von links aus betrachtet haben die Freidemokraten etwas getan, wozu der eigene Hebel schon nicht mehr lang genug ist: eine mögliche Bundesregierung verhindert, die ein Mischwesen aus Merkels Kompromisspolitik, Rechtsauslegerei in zentralen Fragen wie der Migration und einer umverteilungspolitischen Linie geworden wäre, welche die viel beklagte Ungleichheit zementiert hätte. Eine Art Projekt dieser Regierung hat man ohnehin nicht erkennen können. Schwarze Null, bisschen Klima, und sonst verteilen wir den Milliarden-Spielraum für, nun ja: parteipolitische Herzensangelegenheiten. Ein großer gesellschaftspolitischer Wurf schien da ohnehin nicht drin. Das verweist auf ein Problem, das viel größer ist als eine abgebrochene Sondierung: dass eine umsetzbare, also realistische Alternative zu Jamaika so fern liegt, dass die potenziell Beteiligten nicht einmal an »die Schmerzgrenze« kämen, von der die Verhandler aus Grünen, FDP und Union nun berichten, um die eigene Beweglichkeit ins Schaufenster zu stellen und die anderen als Verursacher eines Scheiterns zu markieren.
Viertens: Wenn es stimmt, dass wir hier die Geräusche eines viel größeren politischen Wandels erleben, könnte eine Irritation wie das Platzen der Sondierung dazu beitragen, das ganze Bild etwas schärfer zu sehen. Worum geht es? Es geht natürlich um einen Riesenhaufen globaler Herausforderungen. Es geht aber unter anderem auch darum, das doppelte Auseinanderdriften von politischer Form und politischem Inhalt in den Blick zu nehmen – weder passen a) die auf das Nationalstaatliche begrenzten politischen Regelungen noch mit der globalen Realität der Ökonomie zusammen (siehe Debatten über Europa, Ungleichheit, Besteuerung oder Freihandel), noch bilden b) die politischen Parteien hierzulande wie noch in der Vergangenheit einigermaßen kohärente Lager ab – die Risse, die heute innerhalb der Parteien verlaufen, sind oft tiefer als diejenigen zwischen ihnen.
Wechselnde Mehrheiten, Minderheitsregierung?
Fünftens: Ein Zeichen für diesen größeren politischen Wandel könnte auch sein, dass ausgetretene Pfade des politischen Geschäfts endlich einmal verlassen werden – so nahe an einer Minderheitsregierung im Bund, die auf wechselnden Mehrheiten fußt, waren wir lange nicht mehr. Warum ist das eine Überlegung wert? Weil trotz aller formalen Hürden die schon früher hier und da geäußerte Idee immer noch richtig ist, dies könnte die politischen Aushandlungsprozesse re-politisieren, die inhaltlichen Fragen wieder mehr in den Vordergrund rücken, damit auch das Gefühl verstärken, es gehe »in der Politik um etwas«, und dieses Etwas sind nicht Koalitionsverträge oder mikropolitische Machtstrukturen innerhalb von Parteien, wo dann die Logik der Apparate sich vor die Vernunft der Problemlösung schiebt. Im Übrigen: Auch andere Länder sind nicht gleich zusammengebrochen, weil mal keine Regierung zustande kam. Man muss diesen Zustand nicht verklären, man muss aber auch nicht immer gleich die Alarmsirene anstellen.
Sechstens: Es ist jetzt schon behauptet worden, eine Neuwahl würde doch nur der AfD nutzen. Ist das so? Es sprechen zwei Argumente dagegen und eine Möglichkeit dafür. Fangen wir mit letzterer an: Wenn eine Wiederholung der medial-politischen Aufmerksamkeitsproduktion unterlassen wird, die der Eklatstrategie der Rechtspartei nützte, wäre das schon einmal ein Anfang. Hinzu kommt, dass die FDP nicht erst in den Sondierungen politische Räume besetzte, die lange Zeit verlassen waren und in denen sich deshalb die AfD austoben konnte. Eine unter Lindner in Richtung populistischer Nationalliberalismus verschobene Partei könnten die Teile der AfD-Wählerschaft attraktiv finden, die nicht gern im rechtsradikalen Zug sitzen. Es muss gar nicht stimmen, dass »das bürgerliche Lager zerfranst, die Bündnisfähigkeit schwindet«, wie nun bilanziert wird. Es könnte auch sein, dass es sich um eine Neuformierung handelt. Die findet aber nicht nur »rechts« statt.
Mehr noch aber: Der kommende Wahlkampf wird nicht mehr derselbe sein können wie der im Spätsommer, das betrifft vor allem die Kanzlerin. Ihre Politik der moderierten Alternativlosigkeit zieht nicht mehr, weil die Idee, es gebe dafür trotz prekärer werdender Mehrheitsverhältnisse eine »bürgerliche Regierungsmehrheit«, nämlich Jamaika, zerplatzt ist. Daraus wird man freilich auch nicht automatisch ableiten können, dass stattdessen politische Alternativen von links nun den großen Frühling erleben werden. Der Weg dorthin ist noch sehr weit. Vielleicht zu weit. Jedenfalls in den bisherigen Formen. Wenn nun Oskar Lafontaine schon von einer neuen Sammlungsbewegung spricht, stellt sich ja auch die Frage, wo sich dann jene sammeln, die einen andern Weg verfolgen wollen.
Was wäre der »gültige Ausdruck« des Zustandes der Republik?
Heinz Bude hat vor ein paar Tagen in der »Zeit« eine Koalition aus den vier Parteien CDU, CSU, Grüne und FDP als den »gültigen Ausdruck« einer Republik bezeichnet, die sich in den vergangenen zwanzig Jahren »tatsächlich von Grund auf verändert hat«. Doch die »Koalition der unwahrscheinlichen Kompromisse« aus »liberal gestimmten Leistungsindividualisten«, der »sozialmoralisch sensiblen Teile der oberen Mitte« und der »konservativ gestimmten Leistungsträger« kommt ja nun nicht zustande. Ist Budes Hinweis deshalb falsch?
Nein, denn er läuft auf den weiter oben schon genannten, wohl springenden Punkt dieser Irritation hinaus: das Form-Substanz-Problem. »Die politischen Parteien überall auf der Welt wollen den Pragmatismus in den Hintergrund und die Programmatik wieder in den Vordergrund stellen«, hat Bude beobachtet – doch zugleich sind sie sich über ihre Programmatik gar nicht sicher. Dabei geht es nicht darum, ob man ein gültiges Programm hat oder ellenlange Kataloge mit Wahlforderungen aufstellen kann. Daran ist kein Mangel. Woran es aber fehlen könnte, sind grundlegendere Antworten, solche, die den politischen Ort einer Organisation benennen, ihn erfahrbar machen.
Noch einmal Bude: »Welche Überzeugungen stehen hier im Widerstreit? Was sind die geistigen Quellen, die links und rechts und bei den Liberalen und den Grünen dazwischen die Politik wieder inspirieren können? Was kann Linkssein, Rechtssein, Liberalsein, Grünsein als Markenzeichen für Wählerinnen und Wähler auf der Suche nach Orientierung heute bedeuten?« Aus dem Verlauf und den Ergebnissen der Jamaika-Sondierung hat man dazu keine Antworten finden können. Vor allem nicht zu der Frage, was Liberalsein und was Linkssein wäre. Wenn Christian Lindners Schritt nun dazu beiträgt, dass über diese Fragen wieder und anders gesprochen wird, mag man ihm gar nicht gram sein.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode