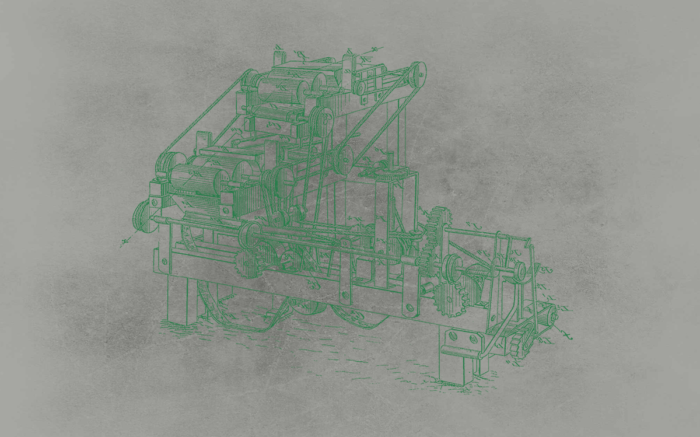Ober-Macht über die Gesellschaft
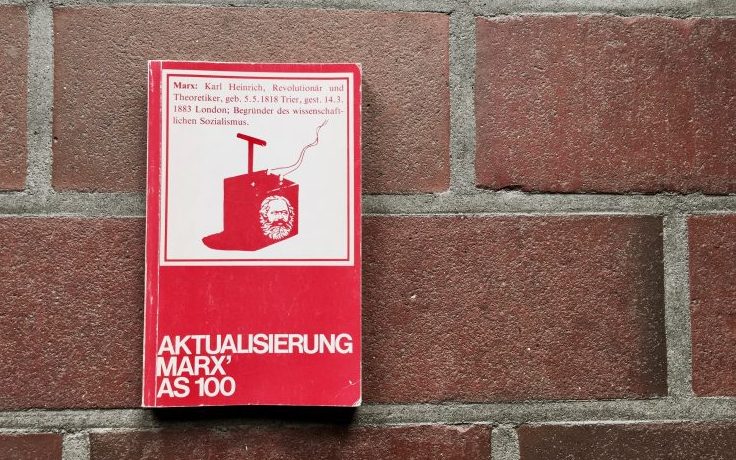 OXI
OXIWiedergelesen: »Was hat eine marxistische Theorie des Staatssozialismus zu erklären«? Karl-Ernst Lohmann stellte 1983 die Probleme der Planung der staatssozialistischen Ökonomien ins Zentrum seines Versuches, die Frage zu beantworten. Für den OXI-Schwerpunkt Planwirtschaft haben wir den Text noch einmal herausgeholt.
»Wir wollen keine Gedenkschrift«, so steht es gleich zu Beginn eines kleinen, roten Bändchens, das 1983 anlässlich des 100. Todestags von Karl Marx erschien. Dem Gemeinschaftsprojekt dreier linker Zeitschriften – der »spw«, der »Prokla« und von »Das Argument« – ging es auch nicht um die »bloßen Versicherungen, dass Marx aktuell sei«. Sondern es sollte um »konstruktive Kritik«, gehen, etwas, das dem »sozialistischen Projekt, das Marx so entscheidend geprägt hat, neue Kraft zuführt«.
Sechs Jahre später war das realsozialistische Projekt, das sich auf Marx berief, dabei den Alten aus Trier aber weitgehend zur bloßen Legitimationsfigur gemacht hatte, am Ende. Wer im Jahr 2017 über Planwirtschaft reden will, kann über die Fehler dieses autoritären Versuchs gesellschaftlicher Steuerung der Reichtumsproduktion und der Verteilung nicht schweigen. Deshalb soll an dieser Stelle an einen der Aufsätze aus dem roten Bändchen zur »Aktualisierung Marx’« erinnert werden – an Karl-Ernst Lohmann Versuch, auf die Frage »Was hat eine marxistische Theorie des Staatssozialismus zu erklären« zu antworten.
»Das Theorem von der Warenproduktion im Sozialismus als Leitfaden für die Analyse des Realsozialismus führt in die Irre«, schreibt Lohmann da – nehme man es »als Metapher, so muss man die Probleme des Staatssozialismus entweder voluntaristisch (aus politischen Fehlentscheidungen) oder aus seinen ›nicht-sozialistischen Anteilen‹ erklären. Nimmt man es wörtlich, geraten gerade die spezifischen Differenzen in den ökonomischen Formen des Staatssozialismus aus dem Blick.« Die zentralen Probleme hatte Lohmann damals definiert als Übernachfrage und geringe Produktivkraftentwicklung, diese seien »in der Tat die beiden Phänomene des Staatssozialismus, die ihn – nach der Seite der ökonomischen Probleme – vom Kapitalismus unterscheiden«.
Lohmann war seinerzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin, die Debatten in den und zwischen diversen Strömungen der Linken war das Umfeld, in dem er über die Politische Ökonomie des Realsozialismus nachdachte. Und also ging es auch darum, sich erst einmal von diesem Fokus zu verabschieden, der Lohmann zufolge in die Irre führt: dass es die fortexistierende Warenproduktion sei, die der Schlüssel zu den Planungsproblemen im Realsozialismus ist. Lohmann plädiert stattdessen dafür, »den staatlichen Charakter des realsozialistischen (Re-)Produktionsprozesses in den Mittelpunkt der Analyse dieser Ökonomien zu stellen« – auch wenn er sich damit damals, also 1983, »offensichtlich im Widerspruch zu den Ansätzen der marxistischen Orthodoxie« bewegte. Ein sehr weit gefasster Begriff von Orthodoxie ist das, weil »bei aller Verschiedenheit der (linksradikalen, trotzkistischen, marxistisch-leninistischen, radikalsozialistischen etc.) Positionen innerhalb der Marxisten« so etwas wie ein »herrschender Konsens« existiere – eben der, die ökonomische Ursache der Planungsprobleme im Realsozialismus bei der Warenproduktion zu suchen. Diese verhindere oder blockiere gesamtgesellschaftliche Planung.
Die alte Frage nach der Warenproduktion im Sozialismus
Lohmann schreibt weiter: »›Warenproduktion‹ als Metapher für ›Planlosigkeit‹ wird von der Orthodoxie dem Kapitalismus assoziiert, folglich ›Warenproduktion im Sozialismus‹ als ›Muttermal der alten Gesellschaft‹ begriffen, von dem nur die Frage ist, wann bzw. inwieweit es ›abgeschafft‹ wird.« Gemäß der Theorie »sollte die Entwicklung von der Warenproduktion im Kapitalismus über deren Zurückdrängung im Sozialismus zur reinen Gebrauchswert-Planung im Kommunismus führen«. Die Frage, ob im Realsozialismus Warenproduktion herrschte, ob man diese irgendwie »abschaffen« könne und was eigentlich die Indikatoren sind, um von der Existenz der Warenproduktion auszugehen, war einmal eine große Frage in der Linken und hat in kleineren Zirkeln sogar bis heute überlebt.
Lohmann dazu: »Die Problematik des Theorems von der Warenproduktion im Sozialismus wird vollends deutlich, wenn man es nicht als Metapher, sondern wörtlich nimmt. Man hat viel Kluges zu diesem Thema geschrieben – aber man hat versäumt, die Behauptung der Existenz von Warenproduktion im Sozialismus zu beweisen. Man glaubt das nämlich sehen zu können: die geplanten Güter werden gegen gesetzliche Zahlungsmittel hinweggegeben – ergo hat man Verkauf vor sich, und die Güter müssen deshalb Waren, die Zahlungsmittel Geld sein. Aber wenn das gleiche Phänomen in unterschiedlichen ökonomischen Kontexten auftaucht, muss es nicht auch die gleiche Funktion ausüben. Denn daß es einen Unterschied macht, ob in einem Marktsystem zwei Unternehmen einen Kaufvertrag abschließen, dessen Bedingungen (Menge und Preis) sie autonom aushandeln; oder ob in einem Plansystem ein Betrieb auf Geheiß der Zentrale einem anderen Betrieb eine ihm vorgeschriebene Menge eines Gutes zu einem von der Zentrale festgesetzten Preis liefert, das sollte eigentlich klar sein, auch wenn man in beiden Fällen exakt das Gleiche ›sieht‹. Die Subsumtion beider Phänomene unter den Begriff ›Warenproduktion‹ oder ›Ware-Geld-Beziehung‹ vernebelt mehr als sie erhellt.«
Lohmann verweist zudem darauf, dass »nicht alle Produkte im Staatssozialismus käuflich« sind, »vor allem nicht die Produktionsbetriebe selbst, da sie staatliches Eigentum sind. Deshalb gibt es in diesen Ökonomien keine Märkte, auf denen Vermögenstitel (Wertpapiere) gehandelt werden, die einen Zinsertrag abwerfen. Das impliziert, dass dem Geld – genauer: dem Produktionsgeld- eine wichtige Eigenschaft fehlt: es übt nicht die Funktion eines Wertaufbewahrungsmittels aus. Mithin können die Betriebe das Geld nur als Zirkulationsmittel verwenden (oder es bar halten, was nicht lohn).
Während die Unternehmen in kapitalistischen Ökonomien immer die Möglichkeit haben, ihr Geld – anstatt es in Produktivkapital zu investieren – zinsbringend an den Vermögensmärkten anzulegen, haben die sozialistischen Betriebe und der Staat diese Möglichkeit nicht. Deshalb tun sie mit dem Geld das, was sie sinnvollerweise einzig tun können: sie verwenden es zum Kauf. Das liefert die allgemeinste Erklärung dafür, wieso es in den sozialistischen Ländern nicht zu Nachfrageproblemen i.S. von zu wenig Nachfrage kommt (natürlich ist noch nicht erklärt, wieso es zur Übernachfrage kommt).«
Für ihn folgt daraus: »Der ›logische Ausgangspunkt‹ der Untersuchung des Staatssozialismus sollte das sein, was in der Orthodoxie als Endpunkt der Entwicklung auftaucht, nämlich die reine Gebrauchswertplanung. Man müsste dann zeigen, dass diese Form der Planung, weil staatliche Planung, zu Problemen führt, als deren potentielle Lösung dann die Formen ›Geld‹ usw., also ›der Markt‹ erscheint. Das scheint mir die einzige Möglichkeit, aus dem innertheoretischen Dilemma der marxistischen Orthodoxie herauszukommen«, so Lohmann 1983.
Grobziele auf dem behördlichen Instanzenweg
Dann nimmt er sich das System der staatlichen Planung vor – hierin sieht Lohmann den zentralen »Vergesellschaftungsmechanismus staatssozialistischer Ökonomien«. Wie sieht diese Planung aus? Und was folgt daraus? An dieser Stelle ein etwas ausführlicherer Auszug aus Lohmanns Aufsatz:
»Grob skizziert, verläuft der Planungsprozess folgendermaßen: der Staat hat bestimmte Vorstellungen über die zukünftigen Entwicklung seiner ›ökonomischen Umwelt‹, die er nicht oder kaum zu beeinflussen vermag. Relativ zu diesen Vorstellungen legt er zunächst in grober Form die ökonomischen Ziele fest, die er entsprechend seinen Staatsinteressen erreichen will (z.B. bestimmte Wachstumsraten, Menge und Struktur der Investitionen, des gesellschaftlichen und des individuellen Konsums etc.). Diese Grobziele werden dann über jenen behördlichen Instanzenweg, aus welchem ›die Zentrale‹ besteht, aufgeschlüsselt (disaggregiert) und in betriebliche Pläne umformuliert. Über diese Pläne verhandelt die Zentrale mit den Betrieben. Die Verhandlungsergebnisse gehen dann den umgekehrten Weg ›hinauf‹ – und auf höchster Ebene wird schließlich der endgültige Volkswirtschaftsplan beschlossen.
Der Plan muss produziert werden
Der Plan fällt also nicht vom Himmel, sondern muss produziert werden. Die ihn produzieren, sind die Betriebe und die Zentrale. Die Planaufstellung ist also ein (ziemlich aufwendiger) Produktionsprozess, in dem zentrale und dezentrale Informationen (nämlich die wirtschaftspolitischen Ziele des Staates und seine Kenntnisse gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge einerseits, andererseits die Informationen über die konkreten Produktionsbedingungen der einzelnen Betriebe) zu einem Produkt – eben dem ›Plan‹ – verarbeitet werden. Betriebe und Zentrale, die den Plan produzieren, stehen also beim Prozess der Planaufstellung in einem Produktionsverhältnis. Als Arbeitsprozess ist die Planaufstellung zwar ungeheuer kompliziert – aber noch nicht von einem Interessengegensatz bestimmt.
Ein solcher wird jedoch durch den staatlichen Charakter der Planung erzeugt. Staatliche Planung heißt, dass die schließlich beschlossenen Pläne für die Betriebe vollzugsverbindlich sind: der Volkswirtschaftsplan ist staatliches Gesetz. Das impliziert, dass es Sanktionen für Planabweichungen geben muss. Man sieht leicht ein, dass brachiale Gewalt (z.B. Gefängnisstrafen für Planuntererfüllung) als Sanktionsform dysfunktional, sogenannte ›ideelle Stimuli‹ (Orden etc.) hingegen wirkungslos sind. So bleibt als einzige relevante Form der Sanktionen die Variation des betrieblichen Einkommens – und als pars pro toto können wir hierfür die Prämie betrachten.
Wenn wir so staatliche Pläne fassen als Pläne, mit deren (Über- oder Unter-)Erfüllung Einkommensvariationen verbunden sind, dann ändert sich auch der Charakter des Planaufstellungsprozesses: er ist jetzt nicht mehr nur Arbeitsprozess, sondern auch Einkommens(vor)verteilungsprozess. Denn je nachdem, ob der Plan, über den Betriebe und Zentrale miteinander verhandeln, ›leicht‹ oder ›schwer‹ erfüllbar ist, ist das erwartete Prämieneinkommen ›hoch‹ oder ›niedrig‹.
Doppelcharakter des staatlichen Planungsprozesses
Die Einkommensvariationen bewirken, dass vom Standpunkt des einzelnen Betriebs sein Verhältnis zur planenden Zentrale (Staat) ein privates wird: der Betrieb versucht, lediglich einen für ihn selbst günstigen Plan zu erhalten – gleichgültig, welche Auswirkungen dieser Plan auf andere Betriebe hat. De facto aber – und dies zeigt sich spätestens bei der Planausführung – ist er allseitig abhängig von der Produktion der anderen Betriebe und damit von ihren Plänen, die ja deren Produktionsgrundlage bilden. Dieser Doppelcharakter des staatlichen Planungsprozesses ist praktisch der springende Punkt für die Planungsprobleme der staatssozialistischen Ökonomien und muss deshalb auch im Zentrum ihrer theoretischen Analyse stehen.
Das private Verhältnis der Betriebe zum Staat existiert aber nicht nur während der Planaufstellung, sondern auch während der Planausführung. Denn die Planausführung ist nicht nur Produktion physischer Güter, sondern damit zugleich Produktion einer Information für den Staat über den Betrieb und seine Leistungsfähigkeit. Wenn es einem Betrieb in Periode t, während welcher der Plan für Periode t + 1 aufgestellt wird, gelang, die Zentrale über seine Produktionskapazität zu täuschen und einen »weichen« Plan zu erhalten, den er in t + 1 übererfüllt, so erhält er zwar in t + 1 eine hohe Prämie – gleichzeitig weiß nun aber die Zentrale, daß der Plan ›weich‹ war, und sie wird dem Betrieb für Periode t + 2 einen ›anspruchsvolleren‹ Plan verordnen.
So wird der gesamte (Re-)Produktionsprozess bestimmt von seinem staatlichen Charakter, d.h. von der Tatsache, daß es hier – bei der Aufstellung und der Ausführung des staatlichen, ergo vollzugsverbindlichen Planes – auch um die Einkommensverteilung zwischen Staat und Betrieben geht.
Die Betriebe als Prämienmaximierer
Aus dem Gesagten folgt, daß man die Betriebe als Prämienmaximierer theoretisieren muss – allerdings nicht als statische, sondern als intertemporale Prämienmaximierer (wie die Ausführungen über den Zusammenhang von gegenwärtiger Planausführung und zukünftigem Plan zeigen); die Theorie muss also dynamisch sein, d.h. sich über mehrere Perioden erstrecken.
Ist diese Voraussetzung, dass die Betriebe dem Handlungsziel folgen, ihre Prämien zu maximieren, legitim? Sollte man nicht als Sozialist voraussetzen, dass die Betriebe – genauer: Manager und Arbeiter – ›gute Kommunisten‹ mit wenigstens einem bisschen ›Klassenbewusstsein‹ (was hier heißt: Staatsbewusstsein) sind, die um der ›dritten Sache‹ willen arbeiten – und nicht wegen des schnöden Mammons? Das mag empirisch so sein oder auch nicht. Es handelt sich in der Tat um keine empirische, sondern um eine theoretische Voraussetzung. Denn: der Staat, der irgendeine Anreizform (Prämie) institutionalisiert, will, dass die Betriebe die Prämie wollen – andernfalls würde er ja nicht diese Anreizform institutionalisieren. Wenn ich also voraussetze, daß die Betriebe Prämienmaximierer sind, so setze ich lediglich dasjenige theoretisch voraus, was der Staat praktisch voraussetzt.
Im Gegensatz zum Tausch als horizontalem Vergesellschaftungsmechanismus ist die staatliche Planung ein vertikaler Vergesellschaftungsmechanismus. In Marktökonomien tangieren die Produktionsbedingungen eines Unternehmens die Situation anderer Unternehmen (d.h. ökonomische Akteure derselben Ebene). Wenn auf einem Markt mehrere Unternehmen eine Ware mit unterschiedlich produktiven Techniken produzieren und anbieten, so droht dem unproduktivsten das Schicksal, vom Markt verdrängt zu werden – ein horizontaler und ebenso harter wie anonymer Sanktionsmechanismus. Wenn hingegen in staatlichen Planwirtschaften zwei Betriebe ein Gut mit unterschiedlich produktiven Techniken produzieren, dann wird der unproduktivere (mehr Material und Arbeitskräfte verbrauchende) nicht durch den produktiveren Betrieb bedroht. Im Gegenteil: jener jener wird mehr Inputs per Plan zugeteilt bekommen als dieser – und allenfalls vom Staat eine geringere Prämie als dieser erhalten: ein vertikaler und relativ schwacher (und auch nicht anonymer) Sanktionsmechanismus.
»Offenbar verschieden« von der Idee der Planung bei Marx
Die Folgen springen ins Auge. Im Prinzip muss nämlich die Erklärung für die geringen Produktivitätssteigerungen hier: in dem schwachen vertikalen Sanktions- bzw. Vergesellschaftsmechanismus zu finden sein. Es gibt keine dem Konkurrenzmechanismus analoge Automatik, die einem sehr unproduktiv, also mit relativ hohen Produktionskosten arbeitenden Betrieb vor die Alternative ›Produktivitätssteigerung oder Ausscheiden aus dem Markt‹ stellt. Und dies aus einem denkbar einfachen Grund: weil auch der unproduktivste sozialistische Betrieb – dem Staat gehört. Das Schließen eines staatlichen Produktionsbetriebes aber bedeutet, dass ein Teil seines eigenen Produktivvermögens nicht mehr genutzt wird. Und dementsprechend selten kommt so etwas vor.«
Lohmann kommt zu dem Schluss, dass der Staatssozialismus mit der spezifisch staatlichen Form der Planung »offenbar verschieden« ist »von jener von Marx und Engels anvisierten ›Gesellschaft, worin die Produzenten ihre Produktion nach einem voraus entworfnen Plan regeln«. Während bei Marx und Engels der sozialistische Übergangsstaat eine klar umrissene, zeitlich begrenzte Funktion hat, nämlich die politische und ökonomische Entmachtung der Bourgeoisie, hat sich der staatssozialistische Staat wieder zu jener Ober-Macht über die Gesellschaft entwickelt, die eifersüchtig über ihr Politikmonopol wacht (und es auch juristisch fixiert).«
Karl-Ernst Lohmann: Was hat eine marxistische Theorie des Staatssozialismus zu erklären?, in Aktualisierung Marx’, Argument-Sonderband 100, Berlin 1983, S. 191-204.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode