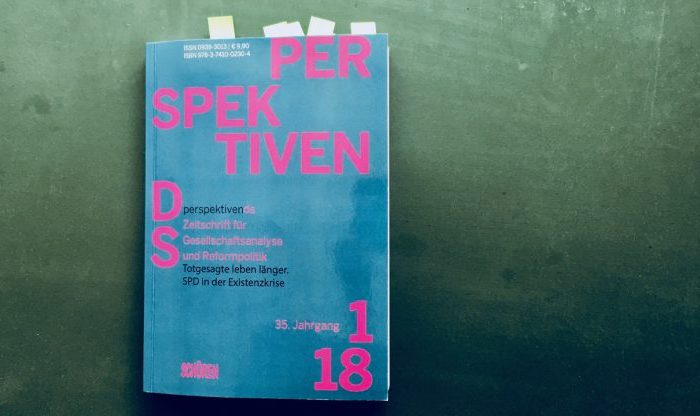Dem Kapitalismus eine Gegenlogik aufzwingen. Oder: Die SPD macht einen Parteitag
 Dirk Ingo Franke, Lizenz: CC BY-SA 3.0Nach Ansicht der Plattform jedenfalls nicht die SPD, die jetzt in die GroKo geht.
Dirk Ingo Franke, Lizenz: CC BY-SA 3.0Nach Ansicht der Plattform jedenfalls nicht die SPD, die jetzt in die GroKo geht.Die SPD hält Parteitag – und man wird die Sozialdemokraten angesichts ihrer Lage kaum beneiden. Viele werden aus dem Wahlergebnis von Martin Schulz die Zukunft der Partei herauslesen wollen. Doch die liegt woanders, unter anderem in der Antwort auf die Frage, wie es gelingt, »demokratische Macht zu organisieren, und dem Kapitalismus in wichtigen Bereichen eine Gegenlogik aufzuzwingen«.
Stellen wir uns einmal vor: Christian Lindner wäre am späten Abend des 19. November vor die Presse getreten, um den Startschuss für Koalitionsverhandlungen hin zu einer Jamaika-Regierung zu verkünden. Die Grünen hätten nicht ganz so überschwänglich in den Armen der Union gelegen. Obergrenze, Klimaschutz, Soli-Abschaffung wären noch ein paar Wochen weiter die Dauerbrenner einer politischen Berichterstattung geblieben, an deren Ende es dann Angela Merkel bestimmt noch gelungen wäre, den Eindruck zu hinterlassen, hier gehe es um ein Projekt. Jemand hätte geschrieben, die nächste Regierung stehe für die praktische Versöhnung innerhalb des bürgerlichen Lagers, die grünen Kinder und die konservativen Eltern sitzen nicht nur wieder an einem Tisch, sondern sogar in einer Regierung.
Hätte, hätte, Fahrradkette – um einen sozialdemokratischen Theoretiker der vergangenen Jahre zu zitieren. Union, Freidemokraten und Grüne haben der SPD den Gefallen nicht getan, sich in der Oppositionsrolle zu erneuern. Oder jedenfalls eine einfache Gelegenheit dazu zu haben. Dass das nötig ist, bezweifelt praktisch niemand mehr bei den Sozialdemokraten. Was Erneuerung heißt, ist freilich so umstritten wie zuvor.
Dass die SPD nun mehr oder minder dazu verdammt ist, auch über eine Große Koalition zu reden, überlagert nun die einander widerstreitenden Erneuerungsansätze. Das wirkt sich sowohl auf die mittlere Sicht aus, denn natürlich wäre es eine andere Voraussetzung, über den eigenen Kurs in Regierungsverantwortung zu reden. Das wirkt sich aber auch auf kurzfristige Sicht aus, denn sofern die Variante GroKo von einigen als Überschreiten der letzten roten Linie bezeichnet wird, verschwinden damit auch politisch-inhaltliche Punkte im Pulverdampf von Selbstverständigungsschlachten. Zumal auch von draußen gehörig eingegriffen wird.
»Eine tatsächliche Sozialdemokratie«?
Im »Freitag« hat Michael Jäger einerseits der SPD geraten, »eine konsequente Programmpartei zu sein« – was darauf hinausläuft, Politik nicht mehr »am Schnittpunkt aller gesellschaftlichen Interessen« zu machen, weil an diesem Schnittpunkt auch das Kapitalinteresse wirkt. Jäger nennt das »eine tatsächliche Sozialdemokratie«, und formuliert andererseits als Bedingung für eine soziale Transformationsstrategie, »die den Kapitalismus überwinden könne«, dass man »dieser SPD die Führung nicht überlassen darf«. Sondern wem? Die Linkspartei hat sich in der Vergangenheit immer einmal wieder als »Motor für einen Politikwechsel« angeboten. Mehr als zehn Prozent wollten da meist nicht mitfahren. Das hat Gründe, und es ist eine Tatsache, die man auch bei der Einschätzung der real existierenden Sozialdemokratie nicht außer Acht lassen kann.
Hinzu kommen unterschiedliche taktische Einschätzungen, wie lang der Hebel nach der gescheiterten Jamaika-Sondierung wirklich ist. Wie viel Bürgerversicherung wäre durchsetzbar gegen die Union? Davon hinge viel ab. Mehr noch hängt von einer kaum zu beantwortenden Frage ab: Wie ein »sozialdemokratischer Fußabdruck« bei künftigen Wahlen vom Souverän bewertet wird. Das ist ja eines der Probleme der SPD: nicht exakt bestimmen zu können, ob man bei der Wahl im Herbst trotz oder wegen der Politik in der Koalition abgewatscht wurde, und wie diese beiden Kräfte in einem komplexen Geflecht von »guten« und »bösen Taten« wirken.
Warum sollte ein strukturveränderndes politisches Projekt wie die Bürgerversicherung anders für die SPD wirken als der Mindestlohn, der sich offenbar »nicht ausgezahlt« hat? Anders gefragt: Wie weit stellt eine Partei ihre organisationspolitischen Interessen (Wahlergebnis) hinter das, was man an sozialen Veränderungen erreichen kann (Programm)? Das hängt sicher auch davon ab, wie man das Verhältnis zwischen den erreichbaren politischen Schritten und einer sozialen Transformationsstrategie bestimmt. Mehr noch hängt es davon ab, ob man eine solche Strategie hat.
Wer anders denkt, ist »schon ziemlich festgerammelt«
Davon ist jetzt in der Öffentlichkeit kaum die Rede, alles dreht sich darum, wie man den nächsten taktischen Schritt politisch so verkleidet, dass er nicht als solcher erscheint. Kritiker der Großen Koalition werden von der Fraktionsvorsitzenden als gedanklich »schon ziemlich festgerammelt« hingestellt, wer sich »zu schnell« auf Neuwahlen oder Opposition festlege, agiere »wie der Vogel Strauß«, der den Kopf in den Sand steckt. Anders herum: Wer die Möglichkeiten in Betracht ziehen möchte, die in einer Großen Koalition stecken, wird Totengräber der Sozialdemokratie genannt, eine Warnung die mit Blick auf die Abwärtskurve bei Wahlen einige Berechtigung zu haben scheint.
Martin Schulz, der am Donnerstagabend erst einmal eine Wahl überstehen muss, sprach von einem »historischen Parteitag«, der mit einer »sehr bedeutenden Richtungsentscheidung« verbunden sei. Das wäre er vielleicht, wenn nicht alles über den Leisten der Großen Koalition gespannt würde. Natürlich verändert diese tagesaktuelle Frage, die beantwortet werden muss, enorm die Beschaffenheit des Spielfeldes, auf dem der sozialdemokratische Ball rollt. »Historisch« ist das aber weniger, der Begriff würde eher passen, wenn die Sozialdemokratie über den Horizont der Tagespolitik hinausschaute.
Hier nun steckt die SPD in einem weiteren Dilemma: Irgendwas tagespolitisch Wichtiges steht immer an; und also ist nie Zeit für die grundsätzlichen, die programmatischen Debatten. Da geht es den Sozialdemokraten nicht anders als Parteien, die nun gern Haltungsnoten an der Seitenauslinie verteilen, dabei aber selbst nicht in der Lage sind, Theorie und Praxis (wieder) in einen engeren Zusammenhang zu bringen, der – zum Beispiel – den Eintritt in einer Regierung nicht schon als Zweck (oder Antizweck) der Politik begreift, weil es – zum Beispiel – über diesen Horizont hinausgehende Ziele gibt, und also die Frage einer Koalition nur beantwortet werden kann, wenn auch klar ist, ob der Weg in eine solche auch auf dem Weg zu einem solchen Ziel liegt. Wozu man allerdings auch ein solches Ziel braucht.
Programmatische Erneuerung – oder nicht?
Wer sich die wichtigsten vorliegenden Papiere anschaut, wird nicht sagen können, dass mehr als die Erwartung, eine programmatische Erneuerung müsste auch auf den Zettel, schon da ist. Es wird sogar teils bestritten, etwa von Olaf Scholz, der sagt, für eine »richtige« SPD-Politik biete die Programmatik schon »genug Handhabe«. Die Spitze der Sozialdemokratie tritt mit zwei Texten vor die Delegierten, die unterschiedlicher nicht sein könnten – was mit dem Jamaika-Aus zu tun hat.
Zunächst wollte man ein Arbeitsprogramm ins Zentrum stellen, das die »Erneuerung in den nächsten Jahren« skizziert und »drei Fragen« beantworten sollte, die durchaus programmatische Tiefe haben: »In was für einer Gesellschaft leben wir heute, vor welchen Veränderungen steht unser Land und wie ist unsere Vorstellung darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen? Welche Gestaltungsaufgaben ergeben sich daraus für sozialdemokratische Politik? Wie stellen wir die SPD programmatisch und organisatorisch neu auf?« Immerhin richtige Fragen.
Dann kam das Jamaika-Aus. Und so liest sich nun das zweite Papier wie eine kurze Zusammenfassung des Wahlprogramms, formuliert also schon zu kurz greifende Antworten. Aufgelistet sind sozialdemokratische rote Linien, es ist ein Papier nicht für die eigene Partei, sondern eher an die Adresse von Angela Merkel gerichtet: Die »Ansprüche an eine Modernisierung unseres Landes in einem besseren Europa müssen mit konkreten Projekten und Maßnahmen unterfüttert werden«, wird da die Kanzlerin ermahnt. Dann folgen elf Themengebiete und die von der SPD jeweils dort vertretenen Bedingungen.
Das Antragsbuch zum SPD-Parteitag: hier
Die Änderungsanträge zum Leitantrag: hier
Wie man den Begriff der Verhältnisse versteht
Die Parteilinke will anderes. Die Strömung DL21 meint: »Die Existenzberechtigung der SPD liegt in ihrem selbstformulierten Ziel die negativen Folgen des Kapitalismus für die Menschen, vor allem die abhängig Beschäftigten und ihre Angehörigen, abzumildern und Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität durch gerechte Umverteilung und Teilhabe zu ermöglichen.«
Diese historische Tendenz, nur etwas abzumildern, werden wiederum nicht alle Jusos mittragen wollen – der Nachwuchs will mehr: »Eine Abkehr von fehlgeleiteten Konzepten der Vergangenheit und ein radikaler Bruch mit der programmatischen Grundausrichtung der letzten 20 Jahre« seien unausweichlich«, schreiben die Jusos. Aber wie geht das, auf welchem ökonomischen Fundament ist das möglich, was müsste dazu getan werden? Die als »konservativ« bezeichnete Seeheimer schreiben, die SPD brauche »eine moderne sozialdemokratische Idee von der Zukunft und dem Leben im 21. Jahrhundert, die die Richtung vorgibt«.
Aber: Wo läge bei einer Neuausrichtung der Unterschied zum Hamburger Grundsatzprogramm? »Wir erkennen Realitäten an, finden uns aber nicht mit den Verhältnissen ab, wie sie sind«, heißt es da. Es war immer schon eine große linke Frage, wie man den Begriff der Verhältnisse versteht: als etwas im Grunde fortexistierendes, das Besserung erfahren kann – oder als etwas, an dem grundlegend Veränderungen nötig sind, damit Besserung überhaupt möglich wird.
Thomas Meyer hat in der »Neuen Gesellschaft« in einem Gespräch über die Aktualität von Karl Marx unlängst formuliert: »In der Sozialdemokratie war der wichtigste Gedanke von Marx, den er ja tatsächlich schon klar formuliert hatte, der folgende: Eine radikale demokratische Sozialpolitik, mit Arbeitsrecht und Acht-Stunden-Tag, zwingt der kapitalistischen Logik eine Gegenlogik der sozialen Voraussicht und Verantwortlichkeit auf. Dieses soziale Gegenprinzip zur Kapitallogik muss erweitert und zunehmend zur Geltung gebracht werden.« Werde aber »das kapitalistische System mit seiner unbarmherzigen Kapitallogik sich selbst überlassen, steigern sich seine Widersprüche und zerstören die Gesellschaft. In dieser Fassung hat sich die Analyse auch bestätigt«, so Meyer – und man kann das auch als Bilanz realsozialdemokratischer Politik der vergangenen Jahrzehnte auffassen.
Wie viel Zielstrebigkeit kann die Arbeiterbewegung aufbringen?
Die entscheidende Frage kommt dann: Wenn es »eben auch die Möglichkeit« gibt, »demokratische Macht zu organisieren, und dem Kapitalismus in wichtigen Bereichen eine Gegenlogik aufzuzwingen«, wer macht das? Und wie? Oder anders formuliert: »Wie viel Kraft, wie viel Zielstrebigkeit kann die Arbeiterbewegung aufbringen?« Hierin liegt Meyer zufolge die zu findende Antwort, und man muss das nicht deshalb als einen historischen Punkt lesen, nur weil da ein altmodischer Begriff wie Arbeiterbewegung steht. Meyer nennt es »das sozialdemokratische Modell, gestützt auf Marx«. Man kann den Alten aus Trier auch weglassen. Entscheidend wäre, dass eine Antwort gefunden wird. Sicher passiert das aber nicht auf diesem SPD-Parteitag.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode