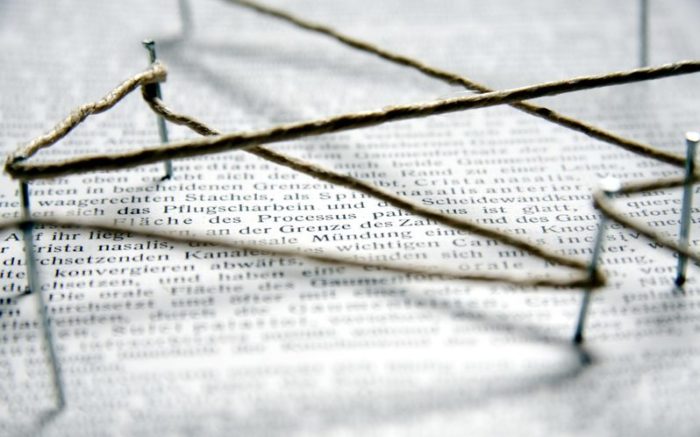Der große Bluff
Die Spieltheorie ist in Wirklichkeit gar keine Theorie. Sie nennt keine überprüfbaren Annahmen über das menschliche Verhalten. Aus OXI 8/22.
Mit Spieltheorie lässt sich Ordnung in unübersichtliche Auseinandersetzungen bringen – ein bisschen wenigstens! Aber trotz des großen mathematischen und theoretischen Aufwands steht dieser wissenschaftliche Ansatz auf wackligen Füßen. Umso bemerkenswerter ist die Selbstsicherheit, mit der Spieltheoretiker Pauschalurteile über den Menschen und seine gesellschaftlichen Möglichkeiten getroffen haben.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Fischer. An der Atlantikküste vielleicht. Jeden Tag fahren Sie hinaus aufs Meer und werfen die Netze aus. Aber Ihre Ausbeute wird immer schlechter. Die Fanggründe sind beinahe erschöpft. Wie lange werden Sie sich und Ihre Familie noch ernähren können? Nur wenn alle sich etwas einschränken, kann die Fischpopulationen sich erholen und in Zukunft den Fischern ein Auskommen bieten. Aber können die Fischer sich darauf einigen, in ihrem eigenen, langfristigen Interesse? Nein, dazu sind sie einfach nicht in der Lage. Jedenfalls behaupten dies viele Spieltheoretiker.
So wie der Biologe Garrett Hardin, der die Geschichte von der »Tragödie der Allmende« erfand. »Als rationales Wesen vergrößert jeder seinen eigenen Nutzen«, heißt es in Hardins einflussreichem Essay, zum ersten Mal erschienen im Jahr 1968 im Magazin »Science«. Die Überausbeutung einer Ressource bringt gleichzeitig Nutzen und Kosten mit sich. Der Nutzen jedes zusätzlichen gefangenen Fischs wird individuell angeeignet, die Kosten dagegen von allen gemeinsam. Sich einzuschränken ist kein gangbarer Weg, weil ein Anreiz dazu besteht, die anderen zu übervorteilen. Deswegen ist es rational, so viel Fisch wie möglich aus dem Meer zu ziehen, obwohl die Ressource so langfristig zerstört wird. »Denn alle kommen zur selben Einsicht. […] Jeder Mensch ist gefangen in einem System, das ihn dazu bringt, seine Ausbeute grenzenlos auszuweiten. […] So richten sie die Allmende zugrunde.«
Die Fischer in diesem Beispiel befinden sich, spieltheoretisch gesprochen, in einem »Gefangenendilemma«: Kooperation brächte ein besseres Ergebnis, aber sie ist keine stabile Strategie. Fischgründe, eine Viehweide oder einen Wald behutsamer und nachhaltiger zu bewirtschaften, wäre langfristig zwar besser für alle, aber Trittbrettfahrer werden die Kosten ihres Verhaltens der Allgemeinheit aufbürden. Daher, argumentiert Hardin, sind Gemeingüter, die für alle zugänglich sind, dem Untergang geweiht. Sie müssen in Privateigentum oder in staatliche Naturschutzgebiete umgewandelt werden, jedenfalls mit unüberwindbaren Zäunen umgeben sein.
Allerdings widersprechen unsere geschichtlichen Kenntnisse dieser vermeintlichen Gesetzmäßigkeit. Zu allen Zeiten und in allen Weltregionen finden wir Beispiele für Bauern- und Fischergemeinschaften, die Gemeingüter bewirtschaftet haben. Die Nutzung der Allmenden war niemals konfliktfrei, aber solchen Gemeinschaften gelang es offenbar, Trittbrettfahrer in die Schranken zu weisen – teilweise jahrhundertelang, teilweise sogar, wenn sesshafte und nomadische Gemeinschaften dieselbe Ressource nutzten. Die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom zeigte später auf, unter welchen Bedingungen Gemeingüter unabhängig von Markt und Staat funktionieren können. »Die Annahme der Spieltheorie war, dass die Menschen nicht in der Lage seien, Wege zu finden, um nicht ausgebeutet zu werden. Aber die Nutzer streiten sich, diskutieren und finden dann Regeln. Und so entwickeln sie Vertrauen zueinander.« Wie Garrett Hardin arbeitete Elinor Ostrom mit spieltheoretischen Modellen, aber auch mit historischen Beispielen und Feldforschung.
Die »Tragödie der Allmende« steht beispielhaft für die Neigung von Spieltheoretikern, ideologische Vorannahmen mit wissenschaftlichen Weihen zu versehen. Dann weisen sie mit methodischer Strenge vermeintlich nach, wie es um den Menschen und seine sozialen Möglichkeiten bestellt ist. Fakten, die nicht zu diesen Annahmen passen, dringen gar nicht mehr durch.
Die ersten empirischen Versuche mit spieltheoretischen Modellen fanden im Jahr 1949 bei der Rand Corporationin den Vereinigten Staaten statt. Die Experimente sahen vor, dass Geldbeträge nach bestimmten Regeln aufgeteilt werden mussten. Ihre Versuchspersonen rekrutierten die Wissenschaftler unter den Angestellten des Instituts. Diese Sekretärinnen ignorierten allerdings souverän die spieltheoretischen Strategien und kooperierten fast immer. Darauf angesprochen bemerkte der Mathematiker und Rand-Mitarbeiter John Nash, einer der Begründer der Spieltheorie: »Wirklich erstaunlich, wie ineffizient die Spieler ihre Auszahlungen optimiert haben. Ich hätte erwartet, dass sie rationaler sind.«
Der sogenannte Homo oeconomicus, der rationale Nutzenmaximierer, diente der Mikroökonomie lange Zeit als Modell, obwohl er sich in den Versuchslaboren von Anfang an nicht blicken ließ. Mittlerweile räumen auch neoklassische Ökonomen und Spieltheoretiker ohne Zögern ein, dass es sich dabei um ein Phantom handelt, eine lebensfremde Abstraktion: ohne Vergangenheit oder Zukunft, ohne Neid oder Gerechtigkeitsempfinden, unbeirrbar in seinen Vorlieben … Er ist blind für die langfristigen Folgen seiner Handlungen, aber dafür unglaublich gut in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit der er seinen Gewinn optimiert.
Die empirische Forschung im Rahmen der Verhaltensökonomik hat nachgewiesen, dass reale Menschen diesem Bild nicht entsprechen. Allerdings ergänzt sie den Homo oeconomicus lediglich durch zusätzliche Bestimmungen wie beispielsweise eine individuelle »Fairness-Präferenz«. Auch dieser Ansatz fasst Nutzen als quantifizierbare und beliebig teilbare Menge auf, die experimentell mit Geldbeträgen ermittelt wird. Den rationalen Nutzenmaximierer auf diese Weise echten Menschen anzunähern gleicht dem Versuch, eine Zeichentrickfigur wie Mickey Mouse dadurch realistischer zu machen, dass man sie in Farbe statt in Schwarz-Weiß zeichnet. Die Form stimmt immer noch nicht.
Dennoch kann Spieltheorie durchaus nützlich sein, weil sie Entscheidungsprobleme handhabbar macht. Sie bringt Ordnung in verwickelte strategische Situationen, in denen das Ergebnis immer auch vom Verhalten anderer Spieler abhängt. Sie übersetzt Handlungsmöglichkeiten und ihre Folgen in Strategien und Auszahlungen, die in Tabellen dargestellt werden. Indem sie Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt, kann sie außerdem verhindern, dass sich Spieler übervorteilen lassen.
Richtig gut funktioniert dies aber nur, wenn die Regeln klar und allgemein bekannt sind, alle Strategien feststehen und die Auszahlungen sich beziffern lassen (am besten in Euro und Cent). Die Spieltheorie ist in Wirklichkeit gar keine Theorie. Sie nennt keine überprüfbaren Annahmen über das menschliche Verhalten, kennt keine Gesetzmäßigkeiten und erlaubt keine Vorhersagen. Sie ist eine nützliche Methode, um strategische Interaktionen darzustellen und zu ordnen – nicht mehr und nicht weniger.
Einigen herausragenden Vertretern der Spieltheorie sind die Grenzen ihrer Methode auch durchaus bewusst. »Obwohl ich seit fast vierzig Jahren auf diesem Gebiet arbeite, suche ich immer noch vergebens nach einer einzigen Anwendung der Spieltheorie in meinem alltäglichen Leben«, bekannte einmal der israelische Ökonom Ariel Rubinstein. »Der große philosophische Wert der Spieltheorie besteht darin, dass sie ihre eigene Unvollständigkeit aufzudecken hilft«, schrieb der kluge Mathematiker Anatol Rapoport. »Sofern die spieltheoretische Analyse konsequent durchgeführt wird, führt sie uns zwangsweise auf andere als strategische Überlegungen.«
Solche ehrlichen und bescheidenen Aussagen sind Ausnahmen. Aufgrund der mathematischen Formalisierung sind spieltheoretische Modelle für Laien kaum nachvollziehbar. Sie erhalten ihre Anziehungs- und Überzeugungskraft durch die Geschichten, mit denen sie illustriert werden. Werden die Verhafteten im Gefangenendilemma einander verraten? Wer wird ausweichen beim sogenannten Feiglingsspiel, wenn die zwei Autos aufeinander zurasen? Diese Erzähltradition kreist um Treue und Verrat, Angst und Gewalt. »In meinen Augen ist die Spieltheorie eine Ansammlung von Fabeln und Sprichwörtern«, erklärte Ariel Rubinstein, und Elinor Ostrom sprach treffend »vom metaphorischen Gebrauch von Modellen«. Die Mischung aus akademischer Autorität und starken Geschichten erlaubte es Spieltheoretiker:innen, erfolgreich ihr Menschen- und Weltbild als »wissenschaftlich belegt« zu verbreiten.
Der Mikroökonomie wird oft vorgeworfen, dass sie den individuellen Nutzen herausstellt und beziffert. In manchen populären Darstellungen (beispielsweise den Schriften von Frank Schirrmacher) wird die Spieltheorie geradezu dämonisiert. Die moralisierende Kritik an der Spieltheorie geht allerdings fehl. Modelle abstrahieren naturgemäß. Abstraktion ist eine Stärke, wenn sie das Wesentliche sichtbar macht, eine Schwäche, wenn etwas Wesentliches aus dem Blick gerät. Der englische Philosoph Kenneth Binmore wehrte sich einmal gegen den Vorwurf, Spieltheoretiker interessierten sich nicht für »Autorität, Schuldzuweisung, Höflichkeit Pflicht, Missgunst, Freundschaft, Schuld, Ehre, Integrität, Gerechtigkeit, Loyalität, Besitzverhältnisse, Hochmut, guter Ruf, Vertrauen und vieles mehr …«. Dies sei keineswegs der Fall. »Vielmehr glauben sie, dass dies Begriffe für emergente Phänomene sind, die auftreten, wenn Menschen versuchen, den Gleichgewichten einen Sinn zu verleihen, wenn sie das Spiel des Lebens spielen.« Binmores apodiktische und etwas polemische Bemerkung ist bezeichnend. Spieltheoretiker wie er trauen Menschen ziemlich wenig zu. Wenn wir »das Spiel des Lebens spielen«, dann geben in Wirklichkeit wir selbst uns die Spielregeln, die darüber entscheiden, was ein Gleichgewicht ist und was nützlich.
Matthias Martin Becker ist freier Journalist und Autor. Unter anderem erschien von ihm 2021 »Klima, Chaos, Kapital – Was über den Kapitalismus wissen sollte, wer den Planeten retten will« bei Papyrossa.
Hardin, Garrett: »The Tragedy of the Commons«, »Science«, Ausgabe 3859, 1968.
Ostrom, Elinor: »Die Verfassung der Allmende: Jenseits von Staat und Markt«, Mohr-Siebeck-Verlag, Tübingen 1999.
Binmore, Ken: »Spieltheorie«, Reclam, Stuttgart 2013.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode