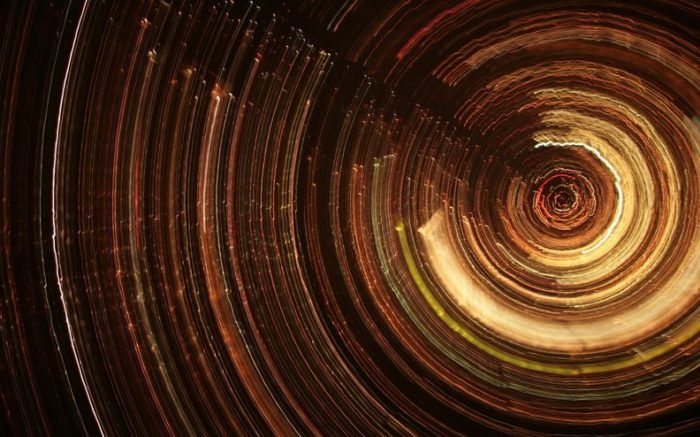Wachstum hat ausgedient – und was wächst nach?
 Foto: Felix Engelhardt / Flickr CC-BY 2.0 LizenzHier hat Wachstum noch nicht ausgedient, aber was wächst nach?
Foto: Felix Engelhardt / Flickr CC-BY 2.0 LizenzHier hat Wachstum noch nicht ausgedient, aber was wächst nach?Es gibt eine Vielfalt an Bewegungen, Positionen und praktischen Beispielen, die einen sozialen und ökologischen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft möglich erscheinen lassen. Es ist an der Zeit, die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen, ohne die Unterschiede zu vergessen.
Manche Ideen widerstehen jeder noch so berechtigten Kritik. Vermutlich weil sie schon immer, wie es heute heißt, postfaktisch gedacht waren. »Die Wirtschaft muss wachsen, denn ohne Wachstum kein Fortschritt« ist so eine Idee. Sie verkennt ein paar wesentliche Punkte: Zum einen leben wir auf einem endlichen Planeten – dem Wirtschaftswachstum sind also Grenzen gesetzt. Es sei denn, es gelingt, Wirtschaftswachstum von Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Doch danach sieht es nicht aus. Tatsächlich erreichen wir jedes Jahr früher den Welterschöpfungstag, ab dem wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde uns innerhalb von zwölf Monaten zur Verfügung stellen kann. Im Jahr 2016 leben wir seit dem 8. August im Öko-Dispo. Es gibt noch einige Rücklagen. Aber bevor wir auch die aufzehren und Kipp-Punkte erreichen, an denen sich kritische Entwicklungen, wie etwa der Klimawandel, unumkehrbar beschleunigen, sollten wir nochmal nach dem Sinn des Ganzen fragen. Denn Wirtschaftswachstum führt nur bedingt zu gesellschaftlichem Fortschritt, beziehungsweise behindert ihn sogar. Unser Indikator für Wachstum ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Er misst allein die ökonomische Wertschöpfung am Markt, blendet also alle anderen gesellschaftlich relevanten Aktivitäten aus. Das wäre in Ordnung, gäbe es weitere Indikatoren, die dieselbe Relevanz für politische Entscheidungen haben wie das BIP. Die nationalen Nachhaltigkeitsindikatoren etwa messen umfassender, wie sich bei uns Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung entwickeln. Aber sie haben nicht annähernd die Bedeutung, die dem BIP zugesprochen wird. Und das bewertet alle Aktivitäten der Wirtschaft positiv, auch wenn sie gleichzeitig die Nachhaltigkeitsindikatoren verschlechtern. Absurd!
Wird der Kuchen größer, bekommen nicht alle ein größeres Stück
Die Erwartung, Wirtschaftswachstum führe zu Fortschritt, basiert zudem auf einer fragwürdigen Annahme: nämlich dass der Reichtum von Kapital- und UnternehmenseignerInnen, der sich durch das Wachstum vermehrt, schon auch irgendwie zu den ärmeren Massen durchsickern wird. Eine Vergrößerung des Kuchens führt dieser Theorie zufolge automatisch dazu, dass mehr und größere Stücke für alle da sind. Mit diesem Trickle-down-Effekt würde sozial ausgleichendes Handeln hinfällig. Eine Analyse der Fakten, wie sie – wenn auch begrenzt – der französische Ökonom Thomas Piketty unternimmt, zeigt: Dieser Effekt tritt ganz offensichtlich nicht ein. Die soziale Ungleichheit ist vielmehr ein Graben, der sich immer weiter öffnet. Dahinter stecken nicht zuletzt eklatante Demokratiedefizite, weil Wachstumsgewinner wie Großunternehmen unter Gewaltenteilung offenbar die Verteilung der Staatsgewalt auf sich verstehen und ihre strukturellen Vorteile weiter ausbauen. An den »Verhandlungen« zu Freihandelsabkommen lässt sich das verdeutlichen: Hier drängen Konzerne massiv auf Gesetze, die dann besagen, dass es gesetzeswidrig ist, Gesetze gegen sie zu machen. Eine Wirtschaftspolitik, die allein als klientelbedienende – postfaktische – Wachstumspolitik verstanden wird, ist offensichtlich schwer zu bewegen, die gesellschaftlichen Gegenkräfte einzubeziehen.
Wachstum lässt sich zurücknehmen
Die Idee vom unendlich-fortschrittlichen Wirtschaftswachstum wird ebenso kritisiert wie verfochten. Verworfen wurde sie bislang nicht. Aber genau das wird derzeit mit Vehemenz auf die gesellschaftliche Agenda gesetzt. Dachbegriffe der wieder erstarkten sozialen Bewegung wachstumskritischer Menschen und Organisationen sind »Degrowth« und »Postwachstum«. Das deutsche Webportal bezeichnet Degrowth als »eine Wirtschaftsweise und Gesellschaftsform, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und die ökologischen Lebensgrundlagen erhält«. In hochindustrialisierten Ökonomien ist dafür eine Rücknahme von (materiellem) Wachstum in Produktion und Konsum unerlässlich. Damit sollen die Belastungen unter die planetaren Grenzen sinken. Den ärmeren, von diesen Belastungen vielfach stärker betroffenen Ländern, wird so ihrerseits gesellschaftlicher Fortschritt (auch durch Wachstum) möglich. Die deutsche Übersetzung ist das offenere »Postwachstum«. Ihr sieht man eher an, dass hier durchaus Richtungsdebatten geführt werden: Es gibt eine Vielfalt an Positionen und Ansätzen jenseits des Wachstumsdogmas. Sie verorten sich in verschiedenen sozialen Bewegungen oder politischen Lagern und streben unterschiedlich weit reichende Veränderungen an. Alle verstehen sich jedoch als Beitrag zu einem sozialen und ökologischen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft.
Es gibt ein Wirtschaften nach dem Wachstum mit einem Genug-für-alle anstatt Von-allem-immer-mehr.
Tweet this
Degrowth ist besonders stark in Südeuropa und dabei ist wichtig zu erkennen: Es ist kein Konzept, das den wirtschaftlichen Zusammenbruch in den Ländern beschreibt oder gar feiert. Vielmehr erklärt es das krisenhafte Schrumpfen unter anderem als Ergebnis des neoliberalen Wachstumsimperativs. Dem setzt das Konzept die Alternative »Degrowth by Design«, entgegen. Denn was Degrowth anspricht, sind nicht nur die drängenden Realitäten eines begrenzten und bereits deutlich übernutzten Planeten. Es sind gerade auch unsere Möglichkeiten, lebensfreundlich mit diesen Begrenzungen umzugehen.
Dies hat nichts mit Rücknahme gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. Stattdessen soll die westliche Fixierung auf ökonomisches Wachstum aufgehoben werden. Diese Fixierung stammt aus Zeiten, in denen Wirtschaft vielleicht Wunder vollbrachte oder Pläne übererfüllte, nicht aber die Ausbeutung von Mensch und Umwelt beendete. Degrowth markiert den Abschied von jeglichen Vorstellungen, dass eine Wirtschaft, die auf Dominanz und Expansion basiert, sozial gerecht und innerhalb planetarer Grenzen möglich sein kann.
Eine andere Wirtschaft als die, die wir haben, ist notwendig. Eine, die in unsere Gesellschaften eingebettet ist.
Tweet this
Eine andere Wirtschaft als die, die wir haben, ist also notwendig. Eine, die in unsere Gesellschaften eingebettet ist, anstatt sie – also uns – zu beherrschen. Deren umweltbelastende Aktivitäten zurückgefahren werden, die vieles andere aber mehrt: das Gemeinwohl und die Gemeingüter, die Lebensqualität und die Solidarität untereinander, die Fähigkeiten und Möglichkeiten, das eigene Leben in Würde zu gestalten und dabei nicht auf Kosten anderer und der Umwelt handeln zu müssen. Das neue Normal im Postwachstum wäre damit allerdings genau die Art zu leben und zu wirtschaften, die unter den gegenwärtigen Bedingungen immer die aufwendigere Alternative ist: selbstbestimmt und kooperativ, mit fairer Beteiligung an den Prozessen und Ergebnissen der Wertschöpfung, mit einem »Genug-für-alle« anstelle des »Von-allem-immer-mehr«.
In Vielfalt verbündet?
Die neue Wachstumskritik kann hier erfolgreicher als es bisherige Versuche waren, Änderungen hervorbringen, wenn es ihr gelingt, die Wachstumsfrage mit weiteren gesellschaftlichen Transformationsfragen und Bewegungen zu verbinden. Beispielsweise finden sich die eben genannten alternativen Wirtschaftsvorstellungen so oder ähnlich auch in der Solidarischen Ökonomie, der Gemeinwohlökonomie, der Kollektiv- und der Genossenschaftsbewegung. In Vernetzungsveranstaltungen, wie auf dem Kongress für Solidarische Ökonomie und Transformation im letzten Jahr in Berlin, wird jedoch auch sichtbar: In typisch linker Bestrebung nach Ausdifferenzierung und Abgrenzung ist das eigene Anderssein oft wichtiger (oder schlicht machbarer) als der gemeinsame Kampf. Dass sie bisher nicht ausreichend verbunden sind, sehen Aktive der unterschiedlichen Bewegungen als mitursächlich dafür an, dass die Alternativwirtschaft noch eine Nische ist. Die Dezentralität und Vielfalt alternativer Ansätze ist unbestritten enorm wichtig. Sie erhöht die Zahl der Lösungswege und die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit. Und sie macht durchaus die Widerstandsfähigkeit der Nische aus. Sie begrenzt aber auch deren Wirkung und Reichweite.
Das Degrowth-Webportal ging daher in die Offensive, um gezielt nach dem Gemeinsamen im Anderen zu suchen. Im Projekt »Degrowth in Bewegungen« beschreiben VertreterInnen aus 32 sozialen Bewegungen, alternativökonomischen Strömungen und Initiativen die Lern- und Bündnismöglichkeiten, die sie mit Degrowth sehen – von Anti-Kohle und Klimagerechtigkeit über Commons (Gemeingüter), Feminismus, Flucht- und Migration bis hin zur Gewerkschafts- und Umweltbewegung. Die neuen Bewegungen sollten es besser als bislang hinbekommen, von den alten wie auch voneinander zu lernen. Zu wissen, wo sie stehen, als einzelne Strömungen und Bewegungen, aber auch als GestalterInnen eines umfassenden alternativen Gesellschaftsentwurfs, ist dafür ein wesentlicher Schritt. Was dann noch fehlt, ist die gemeinsame Stimme, die auf der gesellschaftlichen und politischen Bühne zum sozialen und ökologischen Wandel drängt. Ein Wandel, der die notwendige Vielfalt der Ansätze und Initiativen zu einem starken Gewebe einer solidarischen Wirtschaft und Gesellschaft verknüpft.
Osteuropa kommt mit eigenen Kompetenzen
Die Internationalen Degrowth-Konferenzen für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit sind die größten Sammelpunkte der Bewegung. Sie finden seit 2008 alle zwei Jahre statt, bislang vornehmlich in Europa. Nach Leipzig 2014 ging es in diesem Jahr zur fünften Konferenz nach Budapest. Dies war eine wichtige Entscheidung, weil es an der Zeit ist, gemeinsam mit den Menschen in den postsozialistischen Ländern zu diskutieren, wie gesellschaftliche Transformationsprozesse und kollektive Strukturen der Selbstorganisation gelingen können. Vor allem das Eröffnungspanel mit den Politischen Ökonominnen Danijela Dolenec von der Universität Zagreb und Zoltán Pogátsa von der Westungarischen Universität war vielversprechend für eine solche Erweiterung der Degrowth-Debatte. Beide erklärten, warum das Thema Postwachstum (erst) jetzt in Osteuropa ankommt und was die Menschen in Osteuropa ihrerseits in die Bewegung einbringen könnten. In den post-sozialistischen Ländern galt das materielle Niveau des Westens bislang als Richtschnur der eigenen Entwicklung. Priorität war, ökonomisch aufzuholen und dabei alles, was an den vormals staatlich verordneten Kollektivismus erinnerte, hinter sich zu lassen. Die jungen Generationen erkennen allerdings zunehmend, dass dieses Aufholen illusorisch ist: Osteuropa fungiert eher als Niedriglohn-Werkbank des Westens, der sich wiederum sein materielles Niveau selbst kaum noch leisten kann. Für die Jungen werden daher Bewegungen attraktiv, die eben nicht auf den größeren Kuchen schielen, sondern ein grundsätzlich anderes Rezept des Wirtschaftens suchen. Diese Bewegungen können viel von den Kompetenzen und Erfahrungen der älteren osteuropäischen Generationen lernen: sich dezentral und informell jenseits des Marktes zu organisieren, Gemeingüter kollektiv selbst zu verwalten und Wirtschaft mit einer starken Idee von sozialer Gerechtigkeit zu verknüpfen.
Beweise schaffen, dass es gelingen kann
»Es reicht nicht aus zu verkünden, wir wollen ein anderes ökonomisches System – wir müssen es praktizieren. Dann geben wir ein lebendiges Beispiel, das die Menschen davon überzeugen kann, dass es auch tatsächlich möglich ist.« So beschreibt Jason Nardi von RIPESS, einem internationalen Netzwerk der Solidarischen Ökonomie, den Anspruch einer alternativen Praxis. In der Tat gibt es bereits viele Beispiele von solidarischen, kollektiven, genossenschaftlichen Initiativen in den unterschiedlichsten Wirtschafts- und Lebensbereichen, aber auch von herkömmlichen Unternehmen, die den Wachstumspfad verlassen. Als ‚handfeste‘ Beweise stützen sie nicht nur die politischen Forderungen der Bewegung. Sie sind oft auch bei den Konferenzen dabei und sorgen für eine Erdung der theoretischen Debatten. In Budapest zum Beispiel stand dafür Uwe Lübbermann, Gründer und zentraler Moderator des Internet-Kollektivs »Premium«. Vordergründig vertreibt es Cola, Bier und Limonaden. Sein eigentliches Produkt ist jedoch ein faires, ökologisches und sozial tragfähiges Wirtschaftsmodell, das es vorleben und verbreiten will.
Es reicht nicht aus zu verkünden, wir wollen ein anderes ökonomisches System – wir müssen es praktizieren.
Tweet this
Die vielen bereits funktionierenden praktischen Beispiele solidarischer Ökonomie und kollektiver Initiativen genügen noch nicht, das Blatt zu wenden. Aber sie sind ausreichend, um sich und andere zu ermutigen, dass es zur unumkehrbaren Erschöpfung des Planeten nicht kommen muss.
Dieser Beitrag erschien in der Ausgabe 11/2016 von OXI.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode