Warum wir einen neuen Leistungsbegriff brauchen
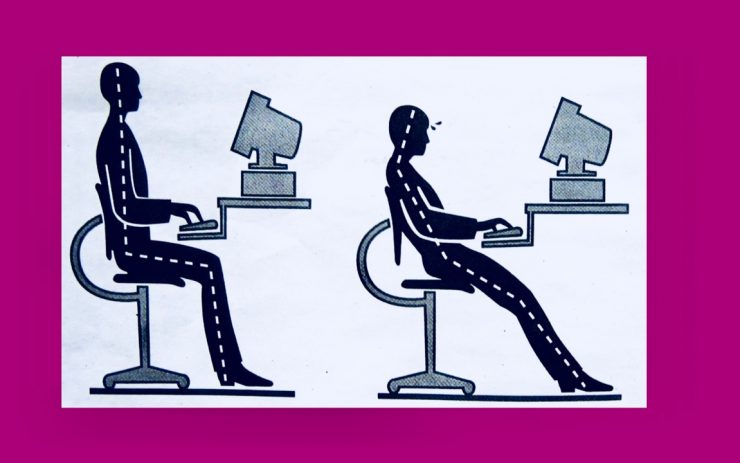 Flickr, Joe Loong , Lizenz: CC BY-SA 2.0
Flickr, Joe Loong , Lizenz: CC BY-SA 2.0Die »Leistung« zählt, behauptet der Kapitalismus – bis die meritokratische Ordnung wackelt. Jeder weiß, dass »Jeder ist seines Glückes Schmied« eine große Lüge ist. Aber »Leistung« ist als emanzipatorische Kategorie trotzdem unverzichtbar. Ein Text aus der gedruckten OXI vom Juni 2019.
Die »Leistungsgesellschaft« ist eine geniale, weil vieldeutig schillernde soziale Erfindung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Individuelle Leistung, nicht soziale Herkunft soll zählen. Unterschiedliche »Leistungen« legitimieren Ungleichheit. Zu große Ungleichheit untergräbt das Vertrauen, dass tatsächlich alle den gleichen Regeln unterworfen sind. Mit Verweis auf die »Leistungsgesellschaft« lassen sich sowohl Steuersätze bis zu 100 Prozent auf große Erbschaften begründen als auch steuerliche Entlastungen für »die Leistungsträger« oder Sanktionen für »Minderleister« und »Leistungsunwillige«. Was als »Leistung« zählt, unterliegt der kollektiven Übereinkunft. Der gesellschaftspolitische Kampf um ihre Deutung bleibt unverzichtbar für emanzipatorische Politik.
Im Mittelpunkt der Leistungsgesellschaft stehen das Individuum und seine »Leistung«. Leistung kommt von »leisten«. Wer etwas leistet, schafft, stellt etwas her, arbeitet. Oder er leistet Folge. Folgt einem Gebot, kommt einer Pflicht nach, verrichtet Frondienst; auch: steht in Diensten und verfügt nicht frei über die eigene Person, was früh Knechte und Mägde von freien Arbeiterinnen und Arbeitern unterschied. Die Selbstverpflichtung, etwas, zum Beispiel Zins und Tilgung, zu leisten, lebt im Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. »Beihilfe« kann laut Gesetz auch geleistet werden. In der reflexiven Variante leistet man sich etwas, überschreitet das alltägliche Allerlei: einen Restaurantbesuch, einen Urlaub, eine Frechheit. Auf jeden Fall sollte das, was man sich leistet, vorher verdient sein. Die Leistungsgesellschaft kennt verschiedene Arten von Leistung: die Dienstleistung, die Beitragsleistung, die Transferleistung, die Spitzenleistung, die Lebensleistung und unzählige Adjektive für Leistungssparten: schulische, sportliche, medizinische, berufliche, seelsorgerische …
Mutter aller Leistungen
Als Mutter aller Leistungen gilt heute die Arbeitsleistung. An sie soll gebunden sein, was am Ende zählt: Einkommen, Anerkennung, Selbstwertgefühl. Neben blanker materieller Not zählt die Sorge, nichts zu leisten, daher als minderwertig zu gelten und ausgeschlossen zu werden, zu den wichtigsten sozialpsychologischen Triebkräften der Leistungsgesellschaft. In einer Meritokratie soll nach Leistung verteilt werden, zuvor muss aber etwas geleistet worden sein. Das moderne Leistungsdenken begreift Leistung als eine systematisch steigerbare, quantifizier- und daher messbare und zweifelsfrei auf ein Individuum rückführbare Größe, die mit den Leistungen anderer Individuen verglichen werden kann. Unterschiedliche Leistungen begründen Unterschiede in Einkommen und Wertschätzung und legitimieren hierarchische Einstufungen. Die Leistungsgesellschaft ohne Messung, Vergleich und Wettbewerb – unvorstellbar.
In ihrer kleinen »Geschichte individueller Leistung als kollektiver Erfindung« verweist Nina Verheyen darauf, dass noch bis ins 20. Jahrhundert die Leistung an sich »noch kein politisch normativer Begriff« war, mit dessen Hilfe die erstrebte Gesellschaft beschrieben wurde. »Auch Bildung und Arbeit wurden unter diesen Begriff noch nicht – wie heute – subsummiert.«
Der Siegeszug der Leistung verdankt sich zwei anderen Entdeckungen: der linearen Zeit und der Physik, die Leistung als Quotient aus Arbeit und Zeit definierte. Marx bezog sich darauf, als er mit dem Begriff der »abstrakten Arbeit« einen Wertmaßstab definierte, der unterschiedlichste konkrete Arbeit hinsichtlich ihres Wertes vergleichbar machen sollte. Die Arbeitswerttheorie zählt zum Nährboden der modernen Leistungsgesellschaft, begründet sie aber nicht.
Verwissenschaftlichung des kapitalistischen Arbeitsprozesses
Als wichtiger Erfinder der »Arbeitsleistung« kann Frederick Winslow Taylor mit seinen Zeitstudien zur Ablaufverbesserung und Ermittlung von Vorgabezeiten betrachtet werden. Die Verwissenschaftlichung des kapitalistischen Arbeitsprozesses sollte die Produktivität durch Arbeitsintensivierung steigern. Sein Augenmerk galt neben der Rationalisierung der fabriklichen Arbeitsorganisation der Standardisierung von Arbeitsvorgängen. Sie richtete sich gegen die Subjektivität der Arbeit: Im Kapitalverhältnis gilt, dass der Arbeiter den Gebrauch seiner Arbeitskraft auf bestimmte Zeit am Tag »verkauft«. Indes bekommt der Kapitalist nicht die bloße Arbeitskraft, sondern den ganzen Menschen, der freudig gestimmt, übellaunig, unwillig, abgelenkt sein kein, auf jeden Fall aber darauf achten wird, so wenig seiner Arbeitskraft wie möglich zu veräußern, um sie vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen.
Die Vorgaben Taylors, die sich an den besten Zeiten orientierten, schufen Standards, denen sich das Subjekt in seiner Tätigkeit unterzuordnen hatte, die die Arbeit des einen aber vor allem »objektiv« vergleichbar mit der Arbeit der anderen machten. Allerdings blieben die Taylor‘schen Innovationen, also Freiwilligkeit, Arbeitsfreude und Eignung, dem Subjekt äußerlich.
Hier setzte etwas später die Psychotechnik, die naturwissenschaftliche Psychologie mit der Typisierung von Persönlichkeitsmerkmalen, an. In Deutschland legte Hugo Münsterberg mit seiner 1912 erschienen Schrift »Psychologie und Wirtschaftsleben« Grundsteine der modernen Lohnarbeitspsychologie. Einer seiner Schwerpunkte waren Eignungstests und die Begründung der wissenschaftlich verpackten Berufsberatung: »Die Aufgabe war«, so Münsterberg, »im Interesse des ökonomischen Erfolges sowie im Interesse der Persönlichkeitsentwicklung die geeignetste Persönlichkeit zu finden.« Allerdings lief die in den USA entwickelte Intelligenz- und Leistungsdiagnostik den Eignungstests im Laufe der Jahre den Rang ab, wenn es darum geht, Individuen nach ihren Fähigkeiten und Eignungen zu ordnen.
Zweitens suchte Münsterberg in der Arbeitsorganisation und -gestaltung »etwaige psychologische Beiträge zur Leistungssteigerung«, denn ein »belebtes Wirtschaftsgetriebe« bedürfe der beständig »gesteigerten Leistungen des Einzelnen«. Technische Rationalisierungen hätten sich bisher »auf die Maschine als solche« bezogen, ohne zu beachten, ob sie »den seelischen Bedingungen der Arbeitenden angepasst war oder nicht«. »Die neue Bewegung aber geht nun darauf aus, diese Angepasstheit bewusst in den Vordergrund zu schieben und systematisch auszuprobieren, mit welcher technischen Variation den psychophysischen Bedingungen am meisten Genüge getan wird.« In langen Versuchsreihen, in denen Bewegung, Aufmerksamkeit und Ermüdung gemessen wurden, erwiesen sich zum Beispiel »für eine Handbewegung von 14 cm 120 Wiederholungen in der Minute als am günstigsten«. Diese Denkweise zielte auf die optimale Abstimmung von Maschine und Mensch, damit »von Anfang an diejenigen Impulse eingeübt werden, die allmählich zur wirtschaftlich besten Leistung führen müssen«.
Formel »Arbeit pro Zeiteinheit«
Die verwissenschaftlichten Methoden zur Nutzung der gemieteten Arbeitskraft erzielten in Deutschland in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihren Durchbruch. 1921 wurde das Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk gegründet, das heute unter dem Namen Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft firmiert. Vielfach beschrieben ist das Auftreten der REFA-Ingenieure (Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation, gegründet 1923) mit ihren Stoppuhren und Klemmbrettern. Eine besondere Rolle spielte das von Carl Arnhold 1925 gegründete Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung (DINTA), das sich der planmäßigen Berufsausbildung und Schulung von Führungskräften widmete und in seinen Lehrwerkstätten arbeitswissenschaftliche Konzepte und den Gedanken der »Betriebsgemeinschaft« erprobte.
Mit der Formel »Arbeit pro Zeiteinheit« setzte sich ein mechanisches, technisch geprägtes Verständnis von Leistung durch. Die Leistungspraktiken zielten nicht auf kurzfristige Spitzenleistungen, sondern auf ein Leistungsoptimum, das über einen längeren Zeitraum (Arbeitstag) hinweg erbracht werden konnte. Es ging um Effizienz, den möglichst sparsamen und langfristig wirkungsvollen Einsatz der Kräfte – ein Leistungsverständnis, mit dem nicht zuletzt auch sozialpolitische Reformen im Sinne der Arbeiterbewegung begründet werden konnten, etwa wenn es darum ging, zum Zwecke des Erhalts der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit den Lebensunterhalt von Arbeitslosen durch Unterstützungsleistungen zu sichern. So warben zumindest bürgerliche Kräfte für die 1927 geschaffene Arbeitslosenversicherung. Erstmals staffelte sie Unterstützungsleistungen nach einem differenzierten Lohnklassen-System und stabilisierte aus dieser Sicht – zeitlich befristet – eine sich in der Lohnhöhe abbildende Hierarchie der individuellen Leistung und volkswirtschaftlichen Nützlichkeit.
Zur »Leistungsgesellschaft« als normativem Ordnungsrahmen für individuelle Leistung formierte sich die deutsche Gesellschaft nach 1933. Die nationalsozialistische Ideologie radikalisierte die Leistungsdiskurse aus den 1920er Jahren und verlangte im Begriff der »Volksgemeinschaft« ständige Kraftanstrengung und unbedingten Leistungswillen. Der Brockhaus sprach 1935 vom »Dienste an der Volksgemeinschaft« als einem »alle Volksgenossen zur Leistungsgemeinschaft verbindenden Schaffen« und nahm erstmals, so Verheyen, das »Leistungsprinzip« in seinen Kanon der Stichworte auf, einen »Grundsatz sozialer und wirtschaftlicher Ordnung und Gliederung«, gemäß dem »zum Wertmaßstab für die Rangordnung innerhalb der Volksgemeinschaft die Leistung des einzelnen für deren Aufbau gemacht« werde. Leistungssteigerung wurde zum Bestandteil von Alltagskultur (zum Beispiel in Gestalt leistungssteigernder Mittel wie Pervitin) und Mentalitäten.
»Jeder ist seines Glückes Schmied«
Der »Leistungsfanatismus« des Nationalsozialismus war »mentaler Treibstoff« der westdeutschen Marktgesellschaft, so Hans-Ulrich Wehler. Zur zentralen Erfahrung der NS-Gesellschaft zählte, dass »Leistung« zu bringen Zugehörigkeit und Anerkennung sichert, aber vor allem auch, wie entscheidend es ist, überhaupt zur Leistungsgesellschaft zugelassen zu sein. Juden, Homosexuellen, Menschen mit Behinderungen, politisch Opponierenden wurde der Zugang systematisch verwehrt, sie galten vielmehr als Schädlinge, die die Leistungsfähigkeit des »deutschen Volkskörpers« schmälerten. Die »Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft« überträgt die produktive Logik der Betriebsgemeinschaft auf die Gesellschaft insgesamt.
Aus der rassisch-völkischen Leistungsgemeinschaft wurde die marktwirtschaftliche Leistungsgesellschaft, in der individueller Status nur an Leistung gebunden sein sollte. In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre stimmten in einer Allensbach-Umfrage über 50 Prozent der Befragten der Aussage zu: »Jeder ist seines Glückes Schmied. Wer sich heute wirklich anstrengt, der kann es auch zu etwas bringen.« Nur ein Drittel unterstützte die Aussage, wenn man unten sei, könne man sich bei den heutigen Verhältnissen noch so anstrengen, man komme nicht hoch.
Allerdings sind vor der modernen Leistungsgesellschaft längst nicht alle gleich oder gehören dazu. Geschlecht und Herkunft sollen a priori immer noch eine geringere Leistungsfähigkeit, ungleiche Bezahlung und niedrigeren Status rechtfertigen. Bestimmte Einwohnergruppen sind mit einem Arbeits- und Leistungsverbot belegt. Andere Gruppen wie Kranke und Rentner sind per gesellschaftlicher Übereinkunft freigestellt, während für Kinder der Eintritt in die Leistungsgesellschaft immer früher stattfindet, etwa bereits bei der Erkundung spezieller Fähigkeiten in mancher Kita. Gleichzeitig zählt in der Schule heute wieder stärker das soziale, kulturelle und ökonomische Kapital der Eltern bei der Erbringung schulischer Leistungen, was bereits früh zeigt, dass vermeintlich individuelle Leistungen soziale Voraussetzungen haben.
Für den Bestand der meritokratischen Ordnung kommt es darauf an, keine massenhafte Überforderung (»Leistungsstress«) hervorzurufen. Aber noch mehr zählt der Glaube an die Gültigkeit der Regeln. Dieser Glaube ist schwer zu erschüttern, weil zirkulär gebaut: Die Formel »Verdienst = Leistung = Intelligenzquotient und Anstrengung je Zeiteinheit« schafft die vermeintlich objektive Basis für Vergleich und Wettbewerb und legitimiert zugleich soziale Ungleichheit. Denn aus der Gültigkeit der Formel folgt notwendig, dass der höhere oder niedrigere Verdienst sich einer besseren oder schlechteren Leistung, einer größeren Anstrengung oder einem höheren Intelligenzquotienten verdanken muss und nicht Zufall oder Willkür. Und umgekehrt gilt: »Die wissenschaftliche (psychologische) Feststellung dieser Begabung macht es den ›Unbegabten‹ zwar nicht leichter, sich mit ihrem ›Schicksal‹ abzufinden, aber aussichtsloser, dagegen etwas zu unternehmen«, so der westdeutsche Psychologe Klaus-Jürgen Bruder 1973.
Verletzung der Ordnung
Den Bindungskräften der meritokratischen Ordnung widersprach das so lange nicht, wie im eigenen Umfeld genügend Menschen vor allem dank höherer Bildungsanstrengungen beziehungsweise längerer Bildungszeiten sozial aufstiegen. So stimmten Anfang der 1980er Jahre fast zwei Drittel der Befragten der obigen Aussage zu, jeder sei seines Glückes Schmied, und weniger als ein Viertel vertrat die Gegenposition. Die verbreitete soziale Erfahrung war, dass es tatsächlich auf den Input, also Intelligenz und Anstrengung ankommt. Zehn Jahre später näherte sich das Verhältnis zwischen beiden Auffassungen erstmals an und 2013 war dann eine Mehrheit der Auffassung, dass alle Anstrengungen nicht zum Aufstieg führen würden.
Seit Mitte der 1990er Jahre vertritt eine Mehrheit der Befragten auch die Auffassung, dass das, was ein Mensch besitzt und verdient, nicht gerecht verteilt ist. Offensichtlich bringt eine Mehrheit wachsende Einkommens- und Vermögensungleichheit nicht mehr mit unterschiedlichen Leistungen zur Deckung. Zu oft wurde die Erfahrung gemacht, dass trotz aller eigenen Anstrengungen die Plätze weiter oben blockiert bleiben, dass es bei Einstellungen weniger auf Eignung als auf soziale Netzwerke und Beziehungen ankommt. Manche sehen Quoten für Frauen oder Behinderte als staatlich sanktionierten Bruch mit der Leistungsordnung; auch Sozialtransfers, denen keine Leistungserbringung vorausging, gelten vielfach als Verletzung der Ordnung.
Unter der Hand hat sich indes etwas geändert, wodurch die meritokratische Ordnung nachhaltig untergraben wird: Der Input zählt weniger als der Output. Dafür stehen an den Erfolg gekoppelte Zielvereinbarungen, die in unterschiedlicher Gestalt auch in Lohnformen eingewandert sind. Jetzt kommt es auf die »Leistung« an, die als Produkt, Dienst oder Werk abgeliefert wird. Wie sie erbracht wurde, wird nebensächlich, gleichgültig, undurchschaubar. Hat der Erfolgreiche tatsächlich mehr geleistet oder hat er einfach mehr Glück, kräftigere Ellbogen, bessere Beziehungen? Die Erfahrung von Willkür und Regellosigkeit im betrieblichen Alltag haben Soziologen wie Klaus Dörre oder Dieter Sauer in den vergangenen Jahren in etlichen Untersuchungen vorgefunden.
Dass nur zählt, was hinten rauskommt, entwickelt sich allmählich zur vorherrschenden Übereinkunft. Regeln verlieren an Bedeutung, zumal wenn ungleiche Einkommen nicht mehr mit unterschiedlicher Leistung begründet werden können, sondern allenfalls noch mit Knappheit an bestimmten Fähigkeiten und Eigenschaften. Schlechte Zeiten für einen wie Sisyphos: Ökonomisch war seine Arbeit immer schon ohne Wert, aber sein beständiges Streben und Mühen verdiente Anerkennung und Respekt. Heute wäre er ob des fehlenden Outputs seiner Arbeit bestenfalls eine bedauernswert lächerliche Person.
Wenn die alte meritokratische Ordnung in den wirklichen Verhältnissen ihre normative Kraft verliert, bekommt ihr Einfordern einen kritischen Impuls – der wiederum seine eigenen Abgründe hat. So zählt in kundenorientierten Berufen zum Erfolg einer Leistung auch die Kundenzufriedenheit. Zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit werden immer mehr Ratings eingesetzt. Die Bewertung einer Leistung, ihre Wertschätzung wird subjektiviert und wieder als soziale Zuschreibung erkennbar, im Gegensatz zu anonymen Marktentscheidungen. Das kritische Potenzial verpufft, wenn die erlahmte Leistungsgesellschaft sich in eine plebiszitäre Bewertungsgesellschaft transformiert.
Wo die alte Ordnung wackelt, kann wieder darüber verhandelt werden, was als Leistung zählen soll. In den vergangenen Jahren verlangten so Müllwerkerinnen und Erzieher größere materielle und soziale Anerkennung für ihre Leistungen. Die einen verwiesen auf die tragende Rolle der Entsorgungsberufe in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Ohne sie wären die Voraussetzungen für die volkswirtschaftliche Produktivität und Leistung anderer in kurzer Zeit nicht mehr gegeben. Die anderen fragten die Gesellschaft, warum das Montieren von Autos so viel besser entlohnt werde als die Betreuung und Erziehung von Kindern, und stellten damit die jahrzehntelang eingeübte Verkoppelung von Wertschöpfung und Leistung in Frage.
Normativer Bezugspunkt gegen Herkunft, Gewalt und Willkür
Zugespitzt wird die Frage, was nach gesellschaftlicher Übereinkunft als Leistung zählen soll, seit einiger Zeit in den Pflegeberufen. Angesichts von Personalknappheit infolge schlechter Entlohnung und angesichts Ökonomisierung der Abläufe tritt der Mangel des vorherrschenden Leistungsbegriffs unmittelbar zu Tage: Zuwendung, Zeit haben, Rücksichtnahme, Freundlichkeit und Umsicht lassen sich nicht rechnen und portionieren. Offenbar muss Leistung anders definiert werden, wenn sie den Bedürfnissen beider Seiten entsprechen will.
»Leistung« ist als emanzipatorische, kritische Kategorie, als normativer Bezugspunkt gegen Herkunft, Gewalt und Willkür trotz allem unverzichtbar für eine demokratische Ordnung. Sie schafft in Form von Produktivität die Voraussetzungen für eine höhere Lebensqualität, steht gegen Ausbeutung und allein auf Willkür und Macht gegründete Ungleichheit. Mit dem Verweis auf die »Lebensleistung« lässt sich für auskömmliche Renten streiten.
Allerdings entfaltet sie dieses kritische Potential nur, wenn erstens der pure ökonomische Erfolg nicht mehr als zentraler Indikator für das gilt, was als Leistung zählen soll, und wenn zweitens akzeptiert wird, dass es weder neutrale Instanzen der Leistungsbewertung noch einen einheitlichen und objektivierbaren Leistungsbegriff gibt, so Claus Offe bereits 1970. Drittens wäre der Leistungsbegriff zu sozialisieren. Es gibt keine individuelle Leistung, die nicht zugleich eine kollektive Anstrengung von vielen ist. Im Zweifel hält der Hausmann unbezahlt den Rücken frei und der Lieferservice bringt den Online-Einkauf ins Haus. Individuelle Leistungen in einer arbeitsteiligen Gesellschaft sind ohne funktionierende Infrastruktur, ohne Kulturleistungen und Vorarbeiten nicht vorstellbar. Und viertens wäre es an der Zeit, den Leistungsbegriff aus der alleinigen Koppelung an Produktivität, die ja selbst eine historische Übereinkunft ist, zu befreien.
Zur »Lebensleistung«, und da schließt sich der Kreis zu frühbürgerlichen Tugenddiskursen, zählt auch das Soziale: Gemeinsinn, Geselligkeit, Familienleben und in einer demokratischen Gesellschaft die Teilnahme am öffentlichen Leben, also Informiertheit, Urteils- und Sprechfähigkeit.
Marx hatte bekanntlich keine Einwände gegen die Steigerung der Produktivität durch bessere Leistung. Vielmehr sah er sie als Voraussetzung, um ein menschliches Leben, verstanden als Entfaltung der Persönlichkeit, in Gesellschaft führen zu können. Die »Leistungsgesellschaft« hat diese Voraussetzungen über alle Maßen entwickelt, die Implosion der meritokratischen Ordnung bietet die Möglichkeit, »Leistung« neu zu erfinden.
Nina Verheyen Die Erfindung der Leistung München 2018 (Hanser-Verlag), auch beziehbar über die Bundeszentrale für politische Bildung.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode











