Was ist Ausbeutung und wenn ja wie viele?
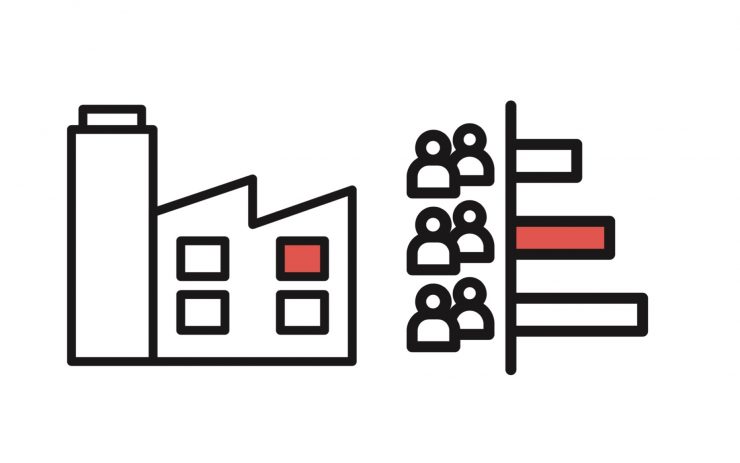 Illustration: Created by Berkah Icon and Rudez Studio from the Noun Project
Illustration: Created by Berkah Icon and Rudez Studio from the Noun ProjectEs sind im Kapitalismus Personen vorhanden, die auch wirtschaftlich genötigt sind, ihre Arbeitskraft frei auf dem Markt zu verkaufen. So hat es Max Weber einmal formuliert. Was sagen ökonomische Theorien zur Aneignung fremder Arbeit? Ein Überblick von Heinz-J. Bontrup.
Trotz des Mythos‘ »Soziale Marktwirtschaft«, haben wir es in Deutschland mit einer kapitalistischen Ordnung zu tun. Die ist zutiefst antagonistisch und verlangt system- bzw. ordnungskonstituierend nach einer rechtlich immanenten Trennung zwischen Produzent (Erwerbsarbeiter) und Produktionsmittel. Dazu schrieb Max Weber: »Es sind im Kapitalismus Personen vorhanden, die nicht nur rechtlich in der Lage, sondern auch wirtschaftlich genötigt sind, ihre Arbeitskraft frei auf dem Markt zu verkaufen. Im Widerspruch zum Wesen des Kapitalismus steht es, und seine Entfaltung ist unmöglich, wenn eine solche besitzlose und daher zum Verkauf ihrer Arbeitsleistung genötigte Schicht fehlt.« Die klassischen Ökonomen sprachen noch offen von Ausbeutung.
Für den Verkauf ihrer Arbeitskraft erhält die Klasse der abhängig Beschäftigten nur einen Ausbeutungslohn, der nicht dem vollen Wert ihrer geleisteten Arbeit entspricht. Bekämen sie den vollen Wert, gäbe es für die Kapitaleigner keinen Mehrwert, also Zins, Grundrente und Profit. Nur wenn der Mehrwert total ausfällt, erhält die Belegschaft eines Unternehmens die von ihr erarbeitete volle Wertschöpfung. Doch auch dann haben die Beschäftigten für die Kapitaleigner die Ewigkeit des Kapitals in Gestalt des als Kosten (Abschreibungen) über die Preise verrechneten und zurückerhaltenen Kapitals erarbeitet. Denn die Summe der zu Wiederbeschaffungspreisen bewerteten Abschreibungen ist gleich der Summe der Ersatzinvestitionen, die dazu dienen, das fixe Kapital, die Produktionsmittel, für die Kapitaleigner zu erhalten. Dennoch können Unternehmen in Insolvenz gehen. Dann werden nicht mehr die vollen Personalkosten, die Zinsen auf das Fremdkapital, Mieten und Pachten und natürlich keine Profite erlöst. Die Verluste zehren das Eigenkapital auf und es fehlt an Liquidität.
Wird aber mit der grundsätzlichen Ausbeutung der Ware Arbeitskraft nicht das in der Ökonomie notwendige äquivalente Tauschprinzip verletzt und dem Arbeiter großes Unrecht angetan? Nein, sagt Karl Marx. Und der Arbeiter empfindet es auch im Grundsatz nicht als ein Unrecht, weil er eben zu seiner individuellen Reproduktion weniger benötigt und damit der Tauschwert der Arbeit, der Lohn, niedriger ausfallen kann, als der Gebrauchswert der Arbeitskraft, den der Arbeiter dem Kapitaleigner und Unternehmer im Produktions- und Verwertungsprozess zur Verfügung stellt.
Damit ist nach Marx im Kapitalismus auch nicht die Höhe des Arbeitslohnes, vorausgesetzt er deckt die Reproduktionskosten der Arbeitskraft und seiner Familie ab, das Problem, sondern ausschließlich die auf privatem Kapital beruhende, mehrwertproduzierende Lohnarbeit, die hier zum systemimmanenten Fluch wird. »Daß ein halber Arbeitstag nötig ist, um ihn (den Arbeiter, d.V.) während 24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert den Arbeiter keineswegs, einen ganzen Tag zu arbeiten. Der Wert der Arbeitskraft und ihre Verwertung im Arbeitsprozeß sind also zwei verschiedene Größen. Diese Wertdifferenz hatte der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft kaufte. (…) Der Geldbesitzer hat den Tageswert der Arbeitskraft gezahlt; ihm gehört daher ihr Gebrauch während des Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, daß die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten kann, daß daher der Wert, den ihr Gebrauch während eines Tags schafft, doppelt so groß ist als ihr eigner Tageswert, ist ein besondres Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer.«
Für Karl Marx lösen somit im Kapitalismus auch nicht die immer wieder eingeforderten höheren Löhne das grundsätzlich bestehende Ausbeutungsproblem, die hier eh immer an die Konfliktgrenze des Mehrwerts stoßen, sondern nur eine Abschaffung des Kapitalismus kann den Arbeiter wirklich befreien. Deshalb, so seine für die Meisten unerträgliche und gefährliche Botschaft: Die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften sollten bedenken, dass selbst ein großzügig verbessertes Lohnsystem nur gegen Wirkungen (Symptome) kämpft, nicht aber gegen die Ursachen dieser Wirkungen und dass die ständigen »Gewalttaten des Kapitals« gegen die Arbeiter, der »tägliche Kleinkrieg«, nie enden wird.
Vor Marx galt es unter den zeitgenössischen merkantilen Ökonomen im ausgehenden 17. Jahrhundert und noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts sogar als ausgemacht, dass der »beste Lohn« immer der »niedrigste Lohn« sei, der mal gerade, wenn überhaupt, die Reproduktionskosten des Arbeiters decken sollte. Das Volk müsse zur Arbeitsamkeit erzogen (gezüchtigt) werden. Dies würde nur ein niedriger Lohn garantieren, der die Arbeiter in ständiger Not dazu zwingen würde ihre Arbeitskraft immer wieder anzubieten.
Bernhard de Mandeville, ein bedeutender merkantiler Ökonom, schreibt dazu 1803: »Wenn die Menschen einen so außerordentlichen Hang zum Müßiggang und zum Vergnügen haben, aus welchem Grunde sollen wir dann glauben, daß sie arbeiten würden, wären sie nicht durch unmittelbare Notwendigkeit dazu gezwungen? Wenn wir einen Handwerker sehen, der nicht zu bewegen ist, vor Dienstag etwas zu tun, weil er Montag früh noch zwei Shilling von seinem letzten Wochenlohn übrighat, warum sollten wir dann meinen, er wäre überhaupt dazu zu bringen, falls er fünfzehn oder zwanzig Pfund in der Tasche hat? Was würde bei diesem Lauf der Dinge aus unseren Manufakturen werden?« Der Staat habe sich deshalb jeglicher Unterstützung der Arbeiterschaft zu enthalten und Zusammenschlüsse von Arbeitern hätte die Obrigkeit strengstens zu untersagen und entsprechend zu sanktionieren.
Dazu noch einmal de Mandeville: »Mir ist glaubhaft versichert worden, daß ein Pack Bediensteter sich zu solcher Unverschämtheit verstiegen hat, einen Verband zu gründen und Vereinbarungen zu treffen, wonach sie sich verpflichten, nicht für weniger als die und die Summe zu dienen, noch irgendwelche Lasten, Bündel oder Pakete über ein gewisses Gewicht hinaus zu tragen – und was der Bestimmungen mehr sind, die den Interessen ihrer Dienstherren gerade ins Gesicht schlagen und die Zwecke untergraben, denen sie dienen sollen.«
Auch der Vorläufer der ökonomisch klassischen Theorie, William Petty, der die ersten Grundlagen für die späteren Arbeitswerttheorien von Adam Smith, David Ricardo und Karl Marx legte, dachte im Hinblick auf den Arbeiter im Kapitalismus und seine Bezahlung ähnlich wie die Merkantilisten. Nach Petty wird der Lohn der Arbeit immer nur durch die zur Erhaltung der Arbeiter notwendigen Lebensmittel bestimmt. Mehr will auch er ihnen nicht zugestehen. Und er zieht daraus eine lohnpolitische Konsequenz, »denn, wenn man ihm das Doppelte zugesteht, dann arbeitet er auch nur halb so viel, wie er hätte tun können und andernfalls getan hätte; das bedeutet für die Gesellschaft einen Verlust des Ergebnisses von so viel Arbeit.«
Adam Smith, der »geistige Vater der kapitalistischen Ordnung«, ist da »gnädiger«, wenn er 1776 schreibt: »Der Mensch ist darauf angewiesen, von seiner Arbeit zu leben, und sein Lohn muß mindestens so hoch sein, daß er davon existieren kann.« Aber er gibt dem Arbeiter im sich schließlich immer mehr entwickelnden Kapitalismus eine ganz schlechte Prognose: »Der bedauernswerte Arbeiter, der gewissermaßen das ganze Gebäude der menschlichen Gesellschaft auf seinen Schultern trägt, steht in der untersten Schicht dieser Gesellschaft. Er wird von ihrer ganzen Last erdrückt und versinkt gleichsam in den Boden, so daß man ihn auf der Oberfläche gar nicht wahrnimmt.«
Die Prognose von Smith ist im weltweiten Maßstab auf jeden Fall eingetreten. Aber auch für die hochentwickelten Industrieländer gilt sie weitgehend. Hier konnten nach dem Zweiten Weltkrieg die abhängig Beschäftigten zwar an den Produktivitätsfortschritten partizipieren. Dies aber seit der Weltwirtschaftskrise von 1974/75 immer weniger. Außerdem war zur Entwicklung des kapitalistischen Systems, dass auf Massenproduktion aufbaut, auch ein Masseneinkommen notwendig. Denn wer soll sonst die Güter und Dienste kaufen?
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einem heftigen Paradigmenwechsel in der ökonomischen Theorienbildung und Lehre. Die Arbeitswerttheorie der Klassiker wurde durch eine subjektive Wertlehre ersetzt. Der Wert einer Ware wird seitdem nicht mehr durch die darin objektiv enthaltenden Arbeitswerte bestimmt, sondern durch die individuelle Wertbeimessung der Waren durch die Wirtschaftssubjekte.
Als Erklärung dafür stellten Joan Robinson und John Eatwell fest: »Klassische Lehrmeinungen, sogar in ihrer liberalsten Form, heben die wirtschaftliche Rolle der sozialen Klassen und der Interessenkonflikte zwischen ihnen hervor. Der Brennpunkt des sozialen Konflikts verlagerte sich im späten 19. Jahrhundert vom Antagonismus der Kapitalisten und Grundbesitzer zum Widerspruch zwischen Arbeitern und Kapitalisten. (…) Lehrmeinungen, die einen Konflikt anregten, waren nunmehr unerwünscht. Theorien, die die Aufmerksamkeit vom Antagonismus der sozialen Klassen ablenkten, waren hoch willkommen. Die unbewusste Voreingenommenheit hinter dem neoklassischen System lag hauptsächlich darin, daß es die Profite auf die gleiche Stufe des moralischen Ansehens hob wie die Löhne. (…) Die nüchterne Haltung der Klassiker, die die Ausbeutung als Quelle des nationalen Wohlstandes anerkannten, wurde aufgegeben (…) und die augenfällige Rationalität des Systems bei der Verteilung des Produkts auf die Produktionsfaktoren verschleiert seitdem die willkürliche Verteilung der Faktoren auf die Menschen.«
Mit der Produktionsfaktorentheorie und der darin angelegten Grenzproduktivitätstheorie wird so jedem Produktionsfaktor (Arbeit, Kapital und Boden) ein eigener Wertbeitrag (das sogenannte Wertgrenzprodukt) zugewiesen. Der jeweilige Faktor, auch der Faktor Arbeit, wird dabei gemäß seiner Grenzproduktivität »entlohnt«. Je höher das Grenzwertprodukt eines Faktors relativ zum anderen ist, umso größer fällt bei gleichen eingesetzten Faktormengen sein Anteil an der Wertschöpfung aus. Jeder der Produktionsfaktoren erhält somit, was er »wert« ist, und das soziale Gewissen bzw. die Gerechtigkeit sind in der Neoklassik befriedigt.
Werner Hofmann stellt dazu fest: »Selbst, wenn das Theorem von der ‚Grenzäquivalenz von Arbeit und Nutzen‘ brauchbar wäre, würde es nur die Beziehung zwischen dem Lohn und dem Angebot an Arbeitskraft bezeichnen. Es bleibt unvollständig, sowie nicht auch die Nachfrage der Unternehmungen nach Arbeitskräften berücksichtigt wird. Diese aber gilt (…) als abgeleitet von der Schätzung des Nutzens der Waren durch den Endkäufer, also durch ganz andere Personen als die beteiligten Arbeiter selbst. So gesehen erklärt das Prinzip der Grenzäquivalenz von Arbeits- und Lohnnutzen nicht die Höhe des Lohnes, sondern vielmehr bestenfalls die vermutliche Reaktion des einzelnen Arbeitenden auf eine schon gegebene Lohnhöhe.«
Laut Grenzproduktivität, die auf einem fundamentalen Irrtum beruht, weil sie Güterproduktivität und Wertproduktivität verwechselt; nur der arbeitende Mensch produziert, nur er bringt Güter als Waren, als Werte hervor; und er bedient sich dabei jener sachlichen Hilfsmittel (Produktionsmittel), die durch die Drei-Produktionsfaktoren-Lehre dem Menschen als dem einzigen »Subjekt der Wirtschaft« fälschlicherweise als gleichartig zur Seite gestellt werden. Aus der Verwechselung von Wert- und Güterproduktivität entspringt auch die Verkennung des wesentlichen Unterschiedes zwischen dem einzig produzierenden menschlichen »Faktor« und seinen sachlichen Hilfsmitteln. Otto Conrad hat dies als die »Todsünde der Nationalökonomie« bezeichnet und sich gegen eine solche Gleichstellung der Produktionsfaktoren mit dem Menschen verwahrt: Niemand käme auf die Idee, dass eine Geige »geigt« oder ein Fernrohr »sieht«. Produktionsmitteln aber werde zur Verklärung, zur Mystifikation, der gesellschaftlichen Wertschöpfung eine eigenständige Leistung zugeordnet.
Aber auch mit der neoklassischen Grenzproduktivitätstheorie kann die Ausbeutung der abhängig Beschäftigten gezeigt werden. Auch hier erhalten die Lohnabhängigen nicht den gesamten Ertrag der Arbeit (bestehend aus dem Output des Faktors Arbeit bei abnehmendem Grenzertrag der Arbeit multipliziert mit dem Verkaufspreis der Ware), sondern nur einen darunterliegenden Lohn. »Der Mehrertrag aller Beschäftigten (gleicher Art), deren Produktivität über derjenigen des Grenzarbeiters steht, fällt auch hier dem Kapital zu.« Der Mehrertrag ergibt sich dabei dadurch, dass in der Theorie der zuletzt eingestellte und zur Produktion gerade noch benötigte Arbeiter gleichen Qualifikationsgrades mit seiner Grenzproduktivität den Lohn für alle anderen mit einer höheren Produktivität bestimmt. Hier gibt es dann eine Obergrenze für den maximal erreichbaren Lohn des Grenzarbeiters.
Oswald von Nell-Breuning schreibt dazu: »Der Unternehmer wird dem letzten eingestellten Arbeiter höchstens so viel Lohn zahlen, wie er im Verkaufserlös des letzten abgesetzten Stückes seiner Produktion wieder hereinbekommt. Würde er mehr Lohn zahlen, dann müßte er ja zusetzen; das will der Unternehmer nicht, und auf Dauer kann er es auch nicht. Das ist gemeint, wenn man sagt: der Arbeitslohn kann die Grenzproduktivität der Arbeit nicht übersteigen (Grenzproduktivität‘ bedeutet also nicht die technische Produktionsleistung, sondern den Geldertrag, den die Verwendung des letzten eingestellten Arbeiters – des ‚Grenzarbeiters‘ – dem Unternehmer einbringt).«
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode











