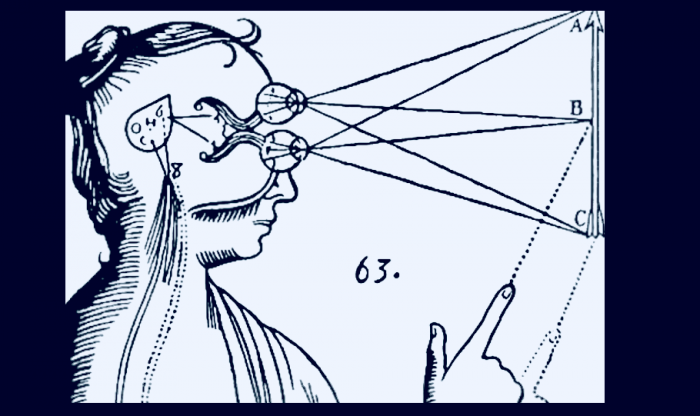Wenn die SPD plötzlich über das Ende von Hartz IV spricht: Ein OXI-Überblick zum solidarischen Grundeinkommen
 Bernd Schwabe , Lizenz: CC BY-SA 3.0
Bernd Schwabe , Lizenz: CC BY-SA 3.0Lange Zeit schien die Debatte über das Hartz-System wie blockiert, allenfalls gegen die umstrittenen Sanktionen hob hier und da einmal ein größerer Chor der Kritik an. Nun sieht es so aus, als habe sich der Wind gedreht. Die SPD redet immer lauter über ein solidarisches Grundeinkommen. Schlagzeilen künden sogar schon vom möglichen Ende von Hartz IV. Was steckt dahinter?
Zunächst einmal ein ziemlich erfolgreiches Agendasetting. Die SPD hat es immerhin geschafft, auf den seit Jahren zu hörenden Ruf, sich ernsthaft von den Agendareformen zu emanzipieren, mit einem nach vorne gerichteten Modell zu antworten. Selbst Anti-Hartz-Initiativen fragen sich, ob nun das Ende des Systems bevorsteht. Die Frage, ob und wie die Sozialdemokraten die sozialpolitische Seite der Regierungszeit von Gerhard Schröder hinter sich lassen könnten, und dabei trotzdem einigermaßen glaubwürdig zu erscheinen, wird hier mit dem Modell solidarisches Grundeinkommen zumindest versuchsweise beantwortet.
Angestoßen wurde das Ganze schon im vergangenen Herbst durch den Regierenden Berliner Bürgermeister Michael Müller. Die Sache drang dann eine Weile nicht durch den Nebel von Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen, im Vertrag zwischen Union und SPD steht auch nicht darüber. Der Vorstoß zum solidarischen Grundeinkommen hat für die Sozialdemokraten also eine strategische Dimension – es könnte eines der Themen für die nächsten Wahlen sein.
In den innerparteilichen Debatten über die Fortsetzung einer Großen Koalition, die so richtig keiner in der SPD will, die sich aber als Zwangsveranstaltung verlängern wird, wenn die Sozialdemokratie nicht wieder mehr Zuspruch erhält, spielt die Überwindung des Hartz-Systems eine wichtige Rolle.
Wenn sie denn kommen würde. Das gilt nicht nur, weil es sozialpolitisch ein hartes Brot ist, sondern auch symbolisch: Was immer man über Ungleichheit in einem reichen Land, arme Kinder, verwehrte Chancen, den Druck und die Kontrolle paternalistischer Transfersysteme oder die disziplinierende Wirkung von drohender Erwerbslosigkeit auf untere Lohneinkommen sagen will, wird man mit dem Schlagwort »Hartz« sagen. Davon wegzukommen wäre ein Kern dessen, was man unter Erneuerung verstehen und erwarten würde.
Eine Überwindung, Abschaffung oder mindestens ein Umbau des bisherigen Systems würde die SPD bündnispolitisch auch wieder flexibler nach links machen – sowohl die Grünen, die vor allem für ihre Kindergrundsicherung geworben haben, also auch die Linkspartei, die sich zum Teil sogar als originäre Anti-Hartz-Kraft gegründet hatte, wären mit einem neuen sozialpolitischen Anfang für die Langzeiterwerbslosen anders ansprechbar als heute.
Was also sagt die SPD?
Was also sagt die SPD? »Wir brauchen eine Alternative zu Hartz IV«, wurde vor ein paar Tagen schon Vizeparteichef Ralf Stegner zitiert. »Das aktuelle System befördert Abstiegsängste, viele Empfänger fühlen sich abgeschrieben, zu wenige schaffen den Übergang in normale Arbeit«, sagte er dem Magazin »Spiegel«. Auch der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich so: »Das System Hartz IV funktioniert nicht richtig. Es diskriminiert und macht echte Aktivierung fast unmöglich.«
Inzwischen reden auch SPD-Politiker so, die nicht dem ohnehin eher Hartz-skeptischen linken Flügel zugerechnet werden. Vizechefin Malu Dreyer sagt, am Ende eines Diskussionsprozesses »könnte das Ende von Hartz IV stehen«. Generalsekretär Lars Klingbeil meinte, »wenn wir den Sozialstaat der Zukunft gestalten wollen, reichen Konzepte, die über 15 Jahre alt sind, nicht mehr aus«. Und inzwischen hat sich auch der zuständige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zur möglichen Einführung eines solidarischen Grundeinkommens eingelassen: »Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden. Ich setze dabei auf konkrete und machbare Lösungen, die der Lebensrealität der Menschen entsprechen«, sagte er der »Bild«.
Müllers Idee und der »soziale Arbeitsmarkt« der GroKo
Die Sache ist noch ziemlich vage, eine realpolitische Brücke hat Klingbeil aber schon vorgezeichnet: Er erinnerte daran, dass die Bundesregierung »schon in dieser Legislaturperiode einen sozialen Arbeitsmarkt für 150.000 Langzeitarbeitslose schaffen« wolle. Vier Milliarden Euro »zusätzlich« seien »für neue Chancen in einem sozialen Arbeitsmarkt für langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger« vorgesehen, heißt es in der Regierungsvereinbarung. Und genauer: »Dazu schaffen wir u. a. ein neues unbürokratisches Regelinstrument im Sozialgesetzbuch II ›Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle‹. Wir stellen uns eine Beteiligung von bis zu 150.000 Menschen vor. Die Finanzierung erfolgt über den Eingliederungstitel, den wir hierfür um vier Milliarden Euro im Zeitraum 2018 bis 2021 aufstocken werden.«
Heil hatte zum »sozialen Arbeitsmarkt« der Koalition angedeutet, ihm würden Lohnkostenzuschüsse vorschweben, die sich über fünf Jahre verringern. Langzeitarbeitslose sollen mit diesen Zuschüssen »in der freien Wirtschaft, bei Wohlfahrtsverbänden oder gemeinnützig für Kommunen arbeiten«.
Das ist nicht das solidarische Grundeinkommen, wie es sich in der Idee von Müller zeigt – aber es wäre politisch sozusagen anschlussfähig. »Arbeitslose, die Hartz IV beziehen oder in die Grundsicherung abzurutschen drohen, sollen ein Angebot für eine unbefristete, sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle erhalten, deren Vergütung sich am Mindestlohn orientiert«, so fasst der »Trierer Volksfreund« das Modell zusammen.
Ein Single bekäme also etwa 1.200 Euro im Monat. »Das sind rund 200 Euro mehr als im Fall von Hartz IV (inklusive Miete und Heizung). Zugleich soll es sich um eine ›gesellschaftliche Tätigkeit‹ in kommunaler Regie handeln. Denkbar sind hier zum Beispiel Jobs als Babysitter, Hausmeister oder Betreuer von Menschen mit Behinderung. Nach Müllers Angaben fallen bei 100.000 solcher Stellen jährliche Mehrkosten in Höhe von 500 Millionen Euro gemessen an den bloßen Hartz-IV-Aufwendungen an.«
Ein Modell für viel zu wenige, ein Etikettenschwindel?
Hier geht nun die Kritik los – und die ist sehr unterschiedlich. So wird zum Beispiel darauf verwiesen, dass bei den Dimension der Müllerschen Idee von einem Ende von Hartz IV schwerlich die Rede sein kann, immerhin sind derzeit fast 4,3 Millionen erwerbsfähige Personen auf Grundsicherung angewiesen. Ein solidarisches Grundeinkommen für alle, vorausgesetzt, die gesellschaftlichen Tätigkeiten gibt es, würde erheblich größere Aufwendungen bedeuten.
Von links wird das Modell zum Teil zudem als Etikettenschwindel abgelehnt, so etwa vom Armutsforscher Christoph Butterwege, der für die Linkspartei schon als Kandidat für das Bundespräsidentenamt angetreten ist. Für ihn läuft das Modell auf »Ein-Euro-Jobs de luxe« hinaus. Solidarisch wäre es erst, so Butterwegge, wenn diese Form der gesellschaftlichen Arbeit auch tariflich entlohnt würde. Ähnlich auch das Urteil von Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung: »Wenn es sinnvolle Arbeit ist, die gebraucht wird, dann soll man sie marktgerecht bezahlen«, wird der Arbeitsmarktexperte in Zeitungen zitiert. »Wenn es keine sinnvolle Arbeit ist, dann kann man es auch sein lassen.«
In der Union und bei der Unternehmenslobby stößt das solidarische Grundeinkommen auch auf Ablehnung – allerdings aus einer anderen Perspektive. »Wenn man Grundsicherung bekommt und kein Druck mehr besteht, eine Arbeit anzunehmen, dann werden sich Menschen in diesem System einrichten. Und dann sind wir wieder bei der alten Arbeitslosenhilfe«, wird der CDU-Politiker Peter Weiß zitiert.
Auf den Zwangseffekt setzt auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. »Unser Sozialsystem beruht aber zu Recht auf dem Grundsatz, dass sich jede und jeder zunächst eigenverantwortlich um die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts bemüht«, sagt Cheflobbyist Ingo Kramer. »Man gibt es auf, mit den arbeitslosen Menschen eine echte Chance auf Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu erarbeiten und verweist massenweise auf künstliche Beschäftigung.« Es müsse beim Prinzip »Fördern und Fordern« bleiben.
Beim unternehmensnahen Institut der deutsche Wirtschaft in Köln meint man, »dieses sogenannte solidarische Grundeinkommen ist nicht dazu geeignet, die bisherige Grundsicherung abzulösen«. Gegen einen Systemwechsel sprächen vor allem drei Gründe, so der zuständige IW-Experte Holger Schäfer – die Freiwilligkeit der Beschäftigungsangebote, die Tatsache, dass Hartz IV auch den Lebensunterhalt für Empfänger absichere, »die bedürftig, aber nicht arbeitslos sind – zum Beispiel Alleinerziehende, die kleine Kinder betreuen«. Und zudem könnten solche Jobs gar nicht für alle 1,7 Millionen arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger geschaffen werden.
Kleiner Unterschied – aber einer ums Ganze?
Der kleine Unterschied könnte einer ums Ganze sein, denn auch wenn ein Öffentlicher Beschäftigungssektor keine sozialpolitische Revolution wäre, darauf liefe das solidarische Grundeinkommen zum Teil hinaus, so wohnt der Idee von Müller die Überzeugung inne, dass der Druck aus dem System genommen werden muss. Wer die Angebote nicht annimmt, soll nämlich »auch weiterhin die Sozialleistungen, die wir kennen«, beziehen. Es gehe »um Freiwilligkeit, keineswegs um Arbeitszwang«.
Stegner spricht sogar von einem »neuen Recht auf Arbeit«. Zieht man hier eine Linie, stünden auf der Seite der SPD auch jene Kritiker des Hartz-Systems, die vor allem die Sanktionen wegen abgelehnter Tätigkeiten, die »angstpolitische« Wirkung von Hartz ablehnen. Es wäre, immerhin für einen Teil der Langzeiterwerbslosen, weniger Fordern und mehr Fördern.
Deshalb muss man nicht in Jubel über die Idee ausbrechen. Natürlich stellt sich die Frage, warum Tätigkeiten, die Müller im Sinn hat – er sprach im Oktober 2017 von »Sperrmüllbeseitigung, Säubern von Parks, Bepflanzen von Grünstreifen, Begleit- und Einkaufsdienste für Menschen mit Behinderung, Babysitting für Alleinerziehende, deren Arbeitszeiten nicht durch Kita-Öffnungszeiten abgedeckt werden, vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten wie in der Flüchtlingshilfe, als Lesepatin oder im Sportverein als Übungsleiter und und und« – nicht als reguläre Tarifjobs des öffentlichen Dienstes und kommunaler Träger geschaffen werden sollten.
Die Erfahrungen mit dem rot-roten ÖBS
Jedenfalls sollte und könnte man hier von den Erfahrungen profitieren, die Berlin mit dem Öffentlichen Beschäftigungssektor schon gemacht hat. In dem Modell waren zwischen 2006 und 2011 etwa 7.500 frühere Langzeiterwerbslose in sozialversicherungspflichtige Jobs gekommen, die ortsüblich aber mindestens mit 1.300 Euro bezahlt wurden. Politisch hatte sich die Linkspartei das auf die Fahnen geschrieben.
Hier liegt ein auch aktueller Aspekt: Die SPD versucht, die Deutungshoheit bei sozialer Sicherheit wieder ein Stück für sich zu beanspruchen. Stegner hatte diese strategische Aufgabe im vergangenen Herbst auch ausdrücklich formuliert. Ein »solidarisches Grundeinkommen« klingt schon besser als der immer etwas bürokratisch daherkommende ÖBS. Dass Müller bei seinem Aufschlag zur Debatte, obgleich er sich an die rot-roten ÖBS-Zeiten erinnern müsste, diesen Vorläufer ausdrücklich verschwiegen hat, verweist auf die diskurspolitische Seite der Debatte: Womit lässt sich Kompetenz auf dem Feld der Sozialpolitik (wieder) erringen?
Der Linkspartei könnte die SPD mit ihrem »solidarischen Grundeinkommen« zumindest ein Thema zur Abgrenzung gegenüber den Sozialdemokraten und zur eigenen »Markenbildung« wegnehmen. Es gibt nicht besonders viele Reaktionen aus der Linkspartei auf die nach Müller angestoßene Debatte, obwohl sich doch die Sache um das Großthema Hartz dreht.
Mal wird auf den ÖBS verwiesen und erklärt, man könnte sich eine Unterstützung auch einer solchen kleinen Korrekturreform vorstellen. »Die Idee, Langzeiterwerbslosen ohne hohe Zugangsschranke eine auf längere Sicht angelegte öffentlich geförderte Beschäftigung anzubieten, räumt mit einer zentralen Lebenslüge von Hartz IV auf und beendet damit erstens die Verengung von Arbeitsmarktpolitik auf ein eng befristetes ‚Training on the Job’«, so hat es der linke Arbeitsstaatssekretär in Berlin, Alexander Fischer im nd formuliert. Es stünde damit zumindest das »Zumutbarkeits- und Sanktionsregime von Hartz IV« in Frage. Auch Fraktionschef Dietmar Bartsch hat sich offen gezeigt. Es handele sich »zumindest eine diskussionswürdige Idee, die sich leider im Koalitionsvertrag nicht widerspiegelt«.
Hier deutet sich eine Kontroverse an. Denn andere in der Partei sehen das nicht so. Linksfraktionschefin Sahra Wageknecht sagte inzwischen, »ein so genanntes solidarisches Grundeinkommen« gehe »in die falsche Richtung, weil damit noch mehr Menschen für Armutslöhne arbeiten sollen«. Die Politikerin erneuerte die Forderung »Hartz muss weg«, und warb stattdessen für »neue und mehr tariflich bezahlte Arbeitsplätze und eine ordentliche Arbeitslosenversicherung«. Manchmal wird auch so gesprochen wie vor der Müller-Debatte: »Hartz IV muss abgeschafft und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden, in Höhe von derzeit 1.050 Euro«, heißt es dann. Die Große Koalition gebe bisher »keine Anzeichen«, dass sie wirklich »Armut bekämpfen« wolle.
Interessanter und womöglich gewollter Nebenaspekt des Müller-Modells: Es führt dazu, dass ständig die Unterschiede zum »bedingungslosen Grundeinkommen« markiert und letzteres dadurch diskurspolitisch in Richtung »unumsetzbar« verschoben wird, während das »solidarische Grundeinkommen« als realpolitische Lösung dasteht. Ein grüner Befürworter des BGE, der Sozialexperte Wolfgang Strengmann-Kuhn, sagt denn auch, Müllers Vorschlag sei »alles andere als ein Grundeinkommen. Es ist eher ein Sozialer Arbeitsmarkt – allerdings in einer schlechten Variante, nämlich einer, die Arbeitslose ausgrenzt. Am Besten ab in den Papierkorb damit.«
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode