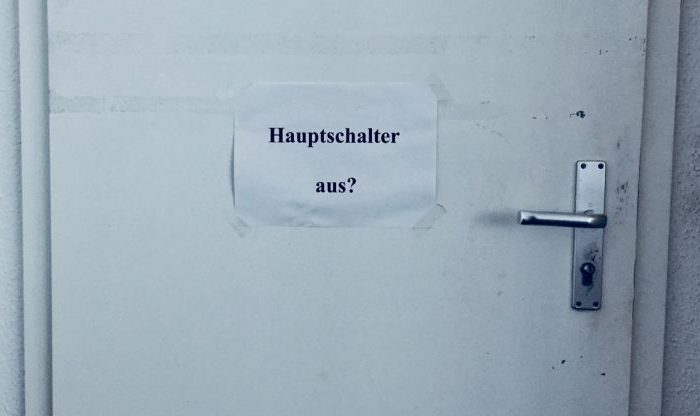Worte die nicht weiterhelfen
 Taken, Pixabay
Taken, PixabayFormeln wie »Externalisierungsgesellschaft«, »imperiale Lebensweise« und »Postwachstum« sind analytisch wenig hilfreich, ihre politisch Mobilisierungskraft äußerst begrenzt. Eine Entgegnung auf Janna Aljets und Tadzio Müller.
Die Themen Klimawandel, Verkehr und Umbau der Industriegesellschaft erfahren gegenwärtig eine verstärkte Aufmerksamkeit, hörbar in Form einer lauter werdenden politischen Debatte und sichtbar in einer wachsenden Zahl von entsprechenden publizistischen Beiträgen. Die »OXI« widmete dem Automobilismus die Nummer 3/19. Zweifelsohne ein wichtiges Thema, doch Zweifel sind erlaubt an der Weise seiner Behandlung. Beispielhaft dafür ist der Aufmacher [Aljets, Müller 2019]. Nicht nur, dass mit Wortgebilden wie »E-Mobilität«, »digitale Mobilität«, »autonomes Fahren«, »nachhaltig«, »post-fossil«, »intelligent vernetzt«, etc. umgegangen wird, als ob sie nicht weiter zu hinterfragendes bezeichneten, auch das Instrumentarium, das dem Automobilismus entgegengesetzt wird, ist alles andere als zweifelsfrei. Besonders die drei, dort in Stellung gebrachten, Formeln »Externalisierungsgesellschaft«, »imperiale Lebensweise« und »Postwachstum« sind wenig hilfreich, ihre analytische Reichweite ebenso wie ihre Fähigkeit, Gegenkräfte zu mobilisieren und tragfähige Alternativkonzepte zu unterfüttern, äußerst begrenzt. Hierzu einige Anmerkungen.
Anscheinend unterstellen die Verwender jener Formeln einen untergründigen Zusammenhang zwischen ihnen, der ungefähr so aussehen könnte: mit »Externalisierungsgesellschaft« sei die stoffliche Grundlage der, implizit als Übel markierten, »imperialen Lebensweise« bezeichnet, während die Aufhebung beider den Übergang in die »Postwachstumsgesellschaft« verlange. Tatsächlich kommt dem Begriff der Externalisierung in der Explikation der »imperialen Lebensweise« eine Schlüsselrolle zu. Die Autoren der letzteren Formel stellen an alle denkbaren Alternativen zu ihr die Forderung, dass »die je spezifische Lebensweise […] verallgemeinerbar sein [muss], ohne ihre Voraussetzungen und negativen Folgen zu externalisieren« [Brand, Wissen 2017, 176]. Dazu und insbesondere zu der Frage, wie realistisch diese Forderung ist, mehr weiter unten. Die Forderungen, die sich mit der Formel »Postwachstum« verbinden, sind weder hinreichend noch notwendig, um dem menschlichen Naturverhältnis eine langfristig tragfähige Gestalt zu geben. Allein das Wachstum zu stoppen oder gar umzukehren, bringt, außer den dabei zu erwartenden makroökonomischen Verwerfungen, überhaupt nichts, sondern dürfte eher kontraproduktiv sein, weil das ja nur den Fortbestand der heutigen, unhaltbaren Strukturen bedeutete. Insbesondere die armen Länder brauchen noch einiges an Wachstum, gerade wenn sie ihre natürlichen Ressourcen schonen wollen — was jedoch auch für die reichen gilt. Das schließt ein, dass viele Produktionen bzw. Produktmengen und Nutzungsformen von solchen verschwinden oder stark schrumpfen müssen, während andere wachsen sollten. Zu denen, die schrumpfen müssen, und insofern ist der Tenor des Aufmachers stimmig, gehört sicher die von Autos, gleichgültig ob mit Verbrennungs- oder Elektromotor.
Wachstum bei sinkendem Ressourcenverbrauch
Es bleibt völlig unklar, was mit der Behauptung genau gemeint sein könnte, dass es »eine absolute ›Entkopplung‹ des BIP-Wachstums vom Ressourcenverbrauch […] nicht [gibt]« [Aljets, Müller 2019]. Weshalb soll das BIP nicht wachsen, während der Ressourcenverbrauch sinkt, wenn verschwenderische Produkte und Nutzungsformen durch qualitativ hochwertige, langlebige und sparsame ersetzt werden, die insbesondere mit einem hohen Maß an menschlicher Dienstleistung — mehr Planung, Anpassung, Reparatur, Wiederverwertung, Beratung, Unterstützung, Betreuung, Bildung etc. — einhergehen? Dass »auch ›grünes Wachstum‹ […] immer eine materielle Grundlage [hat]« [Aljets, Müller 2019], ist sicher richtig, doch folgt daraus nicht, dass Wachstum unbedingt mit erhöhtem Ressourcenverbrauch einhergehen muss. Rainer Land hat die entsprechenden Zusammenhänge im Detail dargelegt [Land 2017]. Worum es geht, ist doch, mehr Qualität mit weniger stofflichem und energetischem Input und Abfall zu produzieren, und das schließt Wachstum nicht aus. Die Tatsache, dass Rebound-Effekte technische Effizienzgewinne bisher allzu oft neutralisiert oder sogar überkompensiert haben — beispielhaft dafür die Effizienzsteigerung bei den Verbrennungsmotoren, die durch wachsende Stückzahlen, schwerere Fahrzeuge mit mehr PS aufgefressen wird — widerlegt nicht die prinzipielle Möglichkeit eines Wachstums ohne Steigerung des Naturverbrauchs, das jedoch nicht allein auf Steigerung der technischen Effizienz setzen kann, sondern mit einer entsprechenden Regulierung auch struktureller und organisatorischer Veränderungen bedarf.
Die Rede von der »imperialen Lebensweise« reduziert gesellschaftliche Verhältnisse einerseits auf individuelle Dispositionen und verallgemeinert andererseits in unzulässiger Weise. Das ist analytisch unergiebig und bringt einen moralischen Ton in die Debatte, der politisch kontraproduktiv ist. Worin läge denn der Gehalt einer Aussage wie der, dass die römischen Bürger zu Zeiten des Augustus sich einer imperialen Lebensweise hingegeben hätten, ganz gleich, ob es sich um Plebejer gehandelt hätte, deren Vorfahren noch dazu in der Lage gewesen wären, Brot, Öl und Wein selbst anzubauen, während jene in die Abhängigkeit von einem Patron gefallen wären, und diesem Patron selbst, der die Lebensmittel durch ein Heer von Sklaven auf seinen, sei es auf der italienischen Halbinsel oder schon in den nordafrikanischen Kolonien gelegenen, Latifundien hätte produzieren lassen — um von den Sklaven ganz zu schweigen? Diese beiden Charaktere teilten doch keine Lebensweise, sondern nahmen weit auseinander liegende Positionen innerhalb Herrschaftsstruktur ein, die in der Tat imperialen Charakter besaß.
Ebenso wenig wie Plebejer und Patrizier im antiken Rom teilen sich doch weder die, die keine Chance haben, ohne Auto zur Arbeit zu kommen oder ihre Besorgungen zu erledigen, noch die, die sich maximal eine Wohnung an den Straßen leisten können, durch die die Masse der ersteren zu ihren Geschäften unterwegs ist, mit den Klattens, Quants, Piëchs, Porsches und den deren Geschäfte besorgenden Funktionseliten eine Lebensweise. Ich sage das als jemand, der nie einen Führerschein besaß und während vieler Jahre erfuhr, wie es ist, in einer ländlichen Gegend zu wohnen, in der eine maximal stündlich verkehrende Buslinie um 18:00h ihren Betrieb einstellt. Zugegebenermaßen profitierte ich ab und zu davon, dass meine Frau mich spät abends mit ihrem Auto von der nächstgelegenen Bahnstation abholte — einem Kleinwagen, den sie brauchte, weil sie sonst ihre Arbeitsstelle nicht erreicht hätte. Auf jeden Fall hilft man weder denen, vor deren Fenster sich Abgase und Lärm ausbreiten, noch denen, die diese zwangsläufig verursachen, noch denen, die die Fahrzeuge dafür montieren, zu vertieften Einsichten in die Zusammenhänge, um von ihrer Mobilisierung für Alternativen ganz zu schweigen, indem man ihnen attestiert, dass sie einer »imperialen Lebensweise« frönten. Wie »imperial« ist zudem eine Lebensweise, die die Masse der Menschen dazu zwingt, mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit allein dafür aufzuwenden, ein Dach über dem Kopf zu haben und das Fahrzeug zu unterhalten, mit dem sie zur Arbeit kommen?
Sozialräumliche Maßverhältnisse gesprengt
Zudem trifft weder dieses Konzept noch das der »Externalisierungsgesellschaft« den Punkt, an dem eine fundamentale Kritik des Automobils ansetzen muss: nämlich den Sachverhalt, dass dieses, gleichgültig ob unmittelbar durch Verbrennung oder elektrisch angetrieben, ob mit oder ohne menschliche Fahrer, die sozialräumlichen Maßverhältnisse sprengt, die urbanes Leben auszeichnen, indem es die durch das Individuum beanspruchte Grundfläche ebenso wie die ihm mögliche Geschwindigkeit um mehr als eine Größenordnung steigert und dieser Steigerung auch noch ein unerhörtes Verletzungs- bzw. Drohpotential zwecks Durchsetzung jenes Anspruchs zur Verfügung stellt. Hier geht es primär um ein, zudem durch die Rechtsordnung abgesichertes, innergesellschaftliches Verhältnis, das die Rollen der Unterlegenheit und Überlegenheit zwischen Fußgängern auf der einen und Autofahrern — und auch noch unter letzteren nach Masse und PS-Zahl des Gefährts — verteilt.
Da der individuelle Verbrauch an Naturressourcen ebenso wie das Ausmaß der Aneignung von fremder Arbeitskraft stark vom Einkommen abhängt, darf man getrost davon ausgehen, dass die bessergestellten akademischen Kreise, für deren Lebensgestaltung und Selbstgefühl die hohe Kunst des ökologisch-moralischen Gewissens eine so bedeutende Rolle spielt, diesbezüglich immer noch die schlechtere Bilanz aufweisen. Die Erfinder der Formel der »imperialen Lebensweise« deuten immerhin an, dass sie davon ein Bewusstsein haben [Brand, Wissen 2017, 139-140], während der Schöpfer der Formel von der »Externalisierungsgesellschaft« den Lifestyle der akademisch gebildeten Besserverdiener für die Norm zu halten scheint — was nicht minder lächerlich ist als dessen Vergleich mit der Marxschen Utopie des frei tätigen Individuums [Lessenich 2018, 126]. Doch letzten Endes sind alle Übungen in persönlicher Bescheidenheit ebenso vergeblich wie technologische Fortschritte im Bereich der Energieeffizienz und der regenerierbaren Energiequellen, solange es keine globale Übereinkunft gibt, die verfügbaren Mengen an mineralischen Energieträgern gezielt auf null herunterzufahren. Ansonsten wird jede Einheit CO₂, die an einer Stelle vermieden wird, lediglich an anderer Stelle emittiert [Flassbeck 2019].
Lifestyle als Norm
In der Tat verbreiten die Medien heute weltweit das Bild von einem Lifestyle als Norm, zu dem all die schicken Dinge gehören, die garantiert nicht verallgemeinerbar sind: ein großzügig geschnittenes und mit allen angesagten Gadgets ausgestattetes Haus, möglichst im Grünen, und vielleicht auch noch eine gleichwertige Stadtwohnung, ein Auto der gehobenen Klasse für jedes fahrerlaubnisfähige Familienmitglied, per Flugzeug zu allen erdenklichen exotischen Zielen, und vieles andere mehr. Dieses Bild entfaltet eine immense Anziehungskraft, d. h. immer mehr Menschen wollen auch so leben bzw. möglichst dorthin, wo man angeblich so lebe, doch sollte man dieses Bild nicht mit der Realität verwechseln, in der sich die Massen einzurichten haben, und vor allem: sind damit die entscheidenden Strukturmerkmale heutiger kapitalistischer Gesellschaften benannt? Daran sind Zweifel möglich.
Man sollte sich auch fragen, worin die Attraktivität jenes Bildes liegt. Es spricht doch nicht zuletzt Urinstinkte an, indem seine Elemente einer Imago des Selbst Material bieten, die den Schutz der Höhle mit der jederzeitigen Möglichkeit von schnellem Angriff und schneller Flucht verbindet; wobei das Automobil, in besonderem Maße das SUV, die Gegenpole der Höhle und der Bewegung auch noch in sich vereint. Vor diesem Hintergrund wäre jedoch der inflationierte Gebrauch der Vokabel »Mobilität« ebenso zu hinterfragen wie der Heiligenschein des Fahrrads als politisch korrektem, »nicht-imperialen« Fortbewegungsmittel. Nicht dass dessen Benutzung des Teufels wäre, doch auch das Fahrrad bedient — wovon man sich in Berlin als Fußgänger einen lebhaften Eindruck verschaffen kann —Bild und Gefühl von Angriff und Flucht bis in die Viszera. Die jetzt zugelassenen E-Roller werden dem sicher eine weitere, für Fußgänger noch schwerer wahrnehmbare und kalkulierbare, Dimension hinzufügen. Die Entwicklung von Alternativen muss sich dagegen das Ziel setzen, kultivierte Lösungen für den Verkehr, also die Befriedigung des, überwiegend deutliche raum-zeitliche Muster ausbildenden, gesellschaftlichen Transportbedarfs zu entwickeln, während die kreatürlichen Bewegungsbedürfnisse auf den ihnen angemessenen Kulturbereich leiblicher Betätigung zu verweisen wären. Angesagt wäre der Abschied von der inhaltsleeren Vokabel »Mobilität« und damit auch von der untergründigen psychischen Dynamik, die diese mit dem gesamten Spektrum vom Roller über das SUV bis zum Jet verbindet.
Nun ist sicher auch der ökologische Fußabdruck eines Hartz-IV-Empfängers immer noch größer als der eines durchschnittlichen Afrikaners, doch ist das kein Ausdruck einer »imperialen Lebensweise«, sondern überwiegend der Notwendigkeit geschuldet, unter den hier gegebenen, geschichtlich gewordenen und damit außerhalb individueller Verantwortung liegenden, Bedingungen zu überleben. Um genau diese Bedingungen zu verändern — hin zu einer dauerhaft aufrechtzuerhaltenden und verallgemeinerungsfähigen, d. h. global gerechten Gestaltung des menschlichen Stoffwechsels mit der Natur —, ist es notwendig, die Masse der Menschen zur Unterstützung dieses Ziels zu bewegen. Doch das ist weder durch moralisierende Formeln noch durch die Beschwörung von Marktkräften, also dem liberalen Surrogat von Moral, mit der in beidem eingeschlossenen Aussicht auf steigende soziale Unsicherheit, zu erreichen. Dazu sind realistische und für die Masse zugängliche Alternativen gefordert, die weder durch die repetierte rhetorische Verdammung der Autogesellschaft noch durch die gebetsmühlenhafte Beschwörung einer abstrakt bleibenden »Mobilitätswende«, herbeizuschaffen sind, die nicht mehr zuwege bringt, als die immer gleichen Wortfetische, »post-fossil«, »nachhaltig«, »intelligent vernetzt« etc., anzuhäufen. Die Zeit drängt in der Tat. Wer sich jetzt an einem solchen Reigen schöner Worte berauscht und sein Augenmerk vor allem auf Fragen richtet wie die, wer die Höchst- und die Minderschuldigen am schlechten Weltzustand und auf den Wettbewerb darum, wer die davon Meistbetroffenen wären, hat ihre Zeichen nicht verstanden.
Destabilisierung, Kriege, Handelspolitik
Zur Bewertung der Formel von der »imperialen Lebensweise« hat Thomas Sablowski ein paar beachtenswerte Gedanken formuliert [Sablowski 2018]. Dabei bin ich mit ihm durchaus nicht in allen Fragen einig. Z. B. bezüglich der wachsenden organischen Zusammensetzung des Kapitals und des tendenziellen Falls der Profitrate bin ich Apostat. Doch wie er halte ich wesentliche Implikationen des Konzepts der »imperialen Lebensweise« für falsch: Es ist ohne Zweifel richtig, dass die Industrieländer den anderen in der Geschichte immensen Schaden zugefügt haben und weiter zufügen, allerdings oft genug, ohne daraus einen signifikanten Gewinn zu erzielen, insbesondere keinen, der der Masse ihrer Bevölkerung zugutekäme. Schon der Sklavenhandel machte zwar einige Leute reich, doch konnte er den wachsenden gesellschaftlichen Reichtum der Industrieländer nicht begründen. In den USA stellte die Sklaverei ein Hemmnis der industriellen Entwicklung dar, welches die diese vorantreibenden Nordstaaten deshalb auch mit Gewalt beseitigten.
Die wichtigsten Handelspartner der Industrieländer gehören ebenfalls dieser Gruppe an oder zu den aufstrebenden Schwellenländern. Weder die Zerstörung der lokalen Textilindustrie durch den Transfer von hier gesammelten Altkleidern noch die der lokalen Landwirtschaft durch den Export von tiefgekühlten Hühnerteilen, noch die Währungs- und Rohstoffspekulation zulasten armer Länder erhöht, sieht man von der geringen Zahl der Profiteure ab, signifikant den Wohlstand der Industrieländer. Den größten Schaden verursachen letztere, indem sie den, deshalb eher zu Unrecht »Entwicklungsländer genannten,« Ländern des Globalen Südens eine Geld-, Fiskal-, Struktur- und Handelspolitik aufzwingen, die Entwicklung praktisch verhindert, und weiter durch gezielte Destabilisierung und Kriege, die die dominierenden Nationen des Westens — oft genug unter dem, vom wohlsituierten, sich ökologisch und politisch für progressiv haltenden, Bürgertum gerne geteilten, Vorwand hehre westliche Werte zu verteidigen — dort anzetteln oder auch selbst führen. Letztere sind der Hauptgrund für Flüchtlingsströme, nicht die »imperiale Lebensweise«. Doch jenseits der in geringerem oder höherem Maße durch Menschen verursachten Katastrophen ist es doch viel weniger so, dass die Flüchtlinge »[…] das universelle Leiden an der imperialen Lebensweise [verkörpern]« [Brand, Wissen 2017, 174], als vielmehr die Attraktivität der bereits angesprochenen, medial allgegenwärtigen Bilder, die scheinbar für jene Lebensweise stehen.
Keine magischen Formeln
Gefordert ist eine internationale Ordnung, die die aufgeführten Perversitäten und insbesondere destruktive, spekulative Finanzströme ausschließt, lokale Produktion schützt und entsprechende Investitionen ermöglicht. Die hier liegenden Probleme sind mit keiner jener magischen Formeln zu fassen, sondern verlangen eine wesentlich konkretere Herangehensweise. Bei all den destruktiven Praktiken geht es doch viel mehr um partikulare Interessen, um politische Herrschaft und das Niederhalten jegliche Konkurrenz und jeglicher Alternative als etwa darum, dass die heutigen, durchaus zu kritisierenden und dringend einer Änderung bedürftigen Nutzungsmuster natürlicher Ressourcen anders nicht durchsetzbar wären. Man muss doch, um es plakativ zu formulieren, keine der Kohle, Erdöl, deren biologische Substitute oder sonstige Mineralien exportierenden Nationen dazu prügeln. Wirklich schwierig wird es sein, mit diesen Ländern einen Weg zu finden, der es ihnen ermöglicht, aus der damit verbundenen Abhängigkeit herauszukommen. Anders wird es nicht möglich sein, die bereit angesprochene, notwendige Bedingung jeglichen langfristigen Klimaschutzes zu realisieren: nämlich die Verfügbarkeit mineralischer Energiequellen graduell auf null zu reduzieren.
Sicher sind die weltwirtschaftlichen Beziehungen durch extreme Asymmetrien geprägt. Es findet im globales Süden die Ausbeutung von Rohstoffen und Arbeitskraft statt und kann man berechtigte Zweifel daran haben, ob die Terms of Trade wirklich fair, und noch größere daran, ob dort vertretbare Arbeitsbedingungen gegeben sind, doch ist das kein Nullsummenspiel: der Reichtum der Industrieländer ist durch Raub allein nicht zu erklären, sondern vor allem durch eine höhere Produktivität. Schon der Gold- und Silberraub der Spanier im 16. Und 17. Jahrhundert wäre völlig sinnlos gewesen, wenn andere europäische Länder nicht parallel dazu ihre Produktion erhöht und die Produkte gegen dieses Gold getauscht hätten — was im Rahmen einer vernünftigen Währungsordnung, zu der die Welt damals überhaupt nicht reif war und es heute immer noch nicht hinreichend zu sein scheint, auch ohne Edelmetall und anderen Unsinn, insbesondere jedoch auch ohne vergleichbaren Schaden, wie ihn dieser Vorgang auch der spanischen Wirtschaft zufügte, möglich wäre.
Schon die stofflichen Grundlagen der Zivilisation Europas, die es ihren dominierenden Nationen schließlich ermöglichte, so wie man das den Wikingern und Mongolen nachsagt, doch mit ungleich weiter reichendem und länger anhaltendem Erfolg, raubend und mordend über die Erde herzufallen, lagen in der europäischen Erde und nicht außerhalb: die hohe Produktivität der Böden im gemäßigten Klima mit ausreichenden Niederschlägen, umfangreiche, dadurch für eine industrielle Nutzung verfügbare, Wasserressourcen, Erze und, erst sehr spät, die Kohle. Sofern Externalisierung dabei eine Rolle spielte, war es die von überschüssiger Bevölkerung. Zu sagen, dass es »uns« nur gut gehe, weil es »denen« schlecht gehe, war und ist falsch und lässt zudem die Frage offen, ob diese »uns« und »denen« nicht doch etwas zu pauschal sei. Es würde vom Reichtum des Nordens einiges übrigbleiben, wenn die Terms of Trade für den Süden besser wären, und erst recht, man darauf verzichten würde, dort explizit Schaden anzurichten. Ich bin sogar der Meinung, dass die Welt insgesamt, inklusive des Nordens, dadurch gewinnen würde. Es geht doch darum, Wege in eine Welt aufzuzeigen, in der es trotz eines reduzierten Ressourcenverbrauchs allen besser geht. In einer Welt, in der die Verbesserung von Lebensbedingungen ein Nullsummenspiel ist, in der die für die einen nur um den Preis einer Verschlechterung der für die anderen möglich ist, bliebe ein solcher Versuch vergeblich.
Vieles, was großen Schaden nicht nur den Ländern des Südens, sondern der gesamten Menschheit zufügt, ist durch den Begriff der Externalisierung nicht zu fassen, etwa die Vernichtung von tropischen Wäldern, an deren Stelle dann Monokulturen für die Produktion von Fetten oder Futtermitteln entstehen. Ein Externalisierungsproblem entsteht dabei in Ländern des Nordens wie der Bundesrepublik, deren Viehbestand die Aufnahmefähigkeit der Landschaft für die Exkremente übersteigt. Zum Schlimmsten gehört vieles, was lange in einem grünen Mäntelchen daherkam und es für viele immer noch tut: Kraftstoffe aus Pflanzen sollten, so hieß es vor nicht allzu langer Zeit und heißt es manchmal auch heute noch, »nachhaltige Mobilität« ermöglichen. Es ist nicht allein die Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau, die daran bedenklich ist, sondern auch der Umstand, dass allzu oft, um vom Verlust an biologischer Vielfalt ganz zu schweigen, bei der Rodung der Flächen für entsprechende Plantagen mehr CO₂ freigesetzt als danach jemals wieder durch Kulturpflanzen gebunden wird. Dieses kurzschlüssige Verständnis von Nachhaltigkeit, war schon bei der Entstehung des Konzepts in der deutschen Forstwirtschaft wirksam, als Wald mit Holzvolumen gleichgesetzt, seine Biodiversität und seine klimatische Funktion ebenso wie seine Bedeutung für die die Bodenqualität und den Wasserhaushalt sowie seine Funktion für die bäuerliche Bevölkerung — z. B. als Weide- und Sammelgrund — ignoriert wurden. Eine genauere Auseinandersetzung mit der weithin unkritischen Verwendung des Begriffs der Nachhaltigkeit findet sich an anderer Stelle [Fischbach 2016, 124-128, 152, 163, 181-184, 229].
Hochmoralische Positionen
In dem Aufmacher-Beitrag ist die Rede davon, dass Mobilität »nachhaltig« und »post-fossil« sein könne, doch bleibt das ohne eine Skizze wenigstens der Umrisse einer Gestalt der entsprechenden Stoff- und Energieflüsse sowie ihrer Wechselwirkung mit dem System Erde und der darin eingebetteten menschlichen Gesellschaft eine Leerformel. Leider ist es, anders als viele hochmoralische Positionen zur Verkehrs- und Energiewende zu unterstellen scheinen, keinesfalls so, dass jene Umrisse jenseits aller Fragen schon geklärt wären. Insbesondere kann Mobilität selbst schon aus naturgesetzlichen Gründen nie »nachhaltig« sein. Bewegung verbraucht immer Ressourcen, die sie selbst nicht bereitstellen kann. Jene Eigenschaft könnte nur dem, den gesamten Lebenszyklus aller Komponenten inklusive der Energieversorgung umfassenden, Gesamtsystem des Stoffwechsels von Mensch und Natur zukommen. Doch genau dies lässt sich mit Gewissheit nie aussagen, denn dazu müsste man dieses Gesamtsystem vollständig erfassen — wessen wir uns nie sicher sein können, zumal umfassende Nachhaltigkeit im Sinne einer vollständigen Reproduktion aller verbrauchten Ressourcen ohnehin unmöglich ist.
Hier ist auf eine Vorstellung hinzuweisen, die im Zusammenhang der Verwendung von Formeln wie »Externalisierungsgesellschaft« und »imperiale Lebensweise« in der grün-linken Diskussion immer wieder auftaucht und weithin für zutreffend gehalten wird, doch dessen ungeachtet falsch ist: die, dass Wälder, insbesondere tropische Regenwälder, CO₂-Senken seien. Das trifft nur auf junge, aufwachsende Wälder zu, während alte, naturnahe Wälder sich dadurch auszeichnen, dass in ihnen organisches Material in allen Phasen des Wachstums und des Zerfalls vorkommt. Ihre CO₂-Bilanz ist deshalb weitgehend ausgeglichen, weil sie das beim Wachstum gebundene CO₂ beim Zerfall wieder freisetzen [Reichholf 2008, 248]. Sie stellen gewaltige Kohlenstoffdeponien dar, weshalb sie sich, durch Rodung, Brände oder Schwächung ihrer Organismen in Folge von Krankheiten, Schädlingsbefall etc., die nicht zuletzt auch als Folge von klimatischem Stress auftreten, in CO₂-Quellen verwandeln. Insbesondere in den warmen Zonen führt das Absterben von organischem Material sehr schnell zu einer vollständigen Zersetzung, sofern dies nicht durch besondere Umgebungsfaktoren verhindert wird, etwa wenn es in extrem sauerstoffarmes Wasser fällt. Letzteres war bei den Karbonwäldern der Fall, aus denen die mineralischen Kohlevorkommen entstanden. Ansonsten findet eine Deponierung geringer Kohlenstoffmengen durch Humusbildung eher in den Wäldern der gemäßigten und borealen Zonen statt. Es ist also nicht so, dass die südlichen Länder CO₂ entsorgten, das die nördlichen externalisierten. Letzteres bleibt, soweit es nicht in den Ozeanen anorganisch und organisch gepuffert wird oder zu ihrer Versauerung beiträgt, in der Atmosphäre und belastet alle, Verursacher und Nichtverursacher, im Prinzip gleichermaßen—wobei zuzugestehen ist, dass die in geringerem Maße verantwortlichen bezüglich der Auswirkungen sich vorläufig oft in einer schlechteren Position befinden — zumindest solange die Niedersachsen und die Niederlande noch nicht Land-unter melden.
Zusammenhänge der Natur ignoriert
Albrecht Müller hat die politischen Schwächen des Konzepts der »Externalisierungsgesellschaft« in einem lesenswerten Aufsatz genauer auseinandergelegt [Müller 2017]. Doch möchte ich ein paar Anmerkungen machen, die über Müllers Kritik hinausgehen: Externalisierung — ich verstehe den Begriff hier zunächst im physikalischen, nicht im psychoanalytischen Sinne, in dem er natürlich auch eine wichtige Rolle spielt — ist ein Prozess, der Leben überhaupt erst ermöglicht. Eine soziologische Kritik, die sie zu ihrem zentralen Punkt macht, bleibt, indem sie fundamentale Zusammenhänge der Natur ignoriert, banal und gerät dadurch zur willkürlichen Skandalisierung von Teilaspekten. Externalisierung ist per se weder gut noch böse, sondern eine Tatsache, die in bestimmten Kontexten allerdings zu Problemen führen kann. Es gibt also durchaus zu kritisierende und vor allem auch praktisch zu bearbeitende Formen von Externalisierung, doch Externalisierung muss nicht immer von Übel sein und längst nicht alles, was es an kritik- und veränderungswürdigen sozialen und ökonomischen Sachverhalten existiert, ist auf Externalisierung zurückzuführen, vor allem aber muss die Kritik an Externalisierung konkret sein. Pauschalisierungen und eine Jeremiade, die überall nur noch böse Externalisierung sieht, helfen nicht weiter.
Das Schema der Externalisierung ist tief in unsere Vorstellungswelt und unsere Sprache eingelassen. Die Autoren des Aufmachers bedienen sich selbst an zentraler Stelle der Externalisierungsmetapher, wenn sie meinen, dass »das Ideal der ›autogerechten Stadt‹ […] als Ausdruck unserer ›imperialen Lebensweise‹ auf die Müllhalde der Geschichte [gehört]« [Aljets, Müller 2019]. Das Pathos, das hier mitschwingt, tönt in meinem Ohr etwas hohl. Ich frage mich, wie ich mir das als materiellen Prozess vorstellen muss und wo es eine andere Stadt zu kaufen gibt. Denn so leicht man als Individuum zumindest deklarativ sich eines Ideals zu entledigen vermag, so schwer ist es, als Kollektiv mit seinen Residuen umzugehen, sofern es einmal materielle Gestalt angenommen und alle sich darauf eingestellt haben. Weder die entsprechend gestaltete physische Welt noch die daran angepassten Menschen wird man einfach auf die Müllhalde werfen können. Der Verdacht liegt nahe, dass hier eine Externalisierung im psychoanalytischen Sinne vorliegt: So sehr man sich, zumindest aus der privilegierten Situation bessergestellter urbaner Schichten heraus, individuell in der Befreiung vom Automobilismus üben mag, so bleibt man doch mit ihm schon durch den gesellschaftlichen Naturstoffwechsel verbunden, um von der Verstrickung tieferer Instinkte mit ihm ganz zu schweigen — eine Situation, in der die Projektion nach außen etwas seelische Entlastung verschafft. Externalisierung im psychoanalytischen Sinne ist offenkundig am Werk, wenn von »der unglaublichen emotionalen Wucht, mit der unsere Körper von Autos angerufen und eingebunden werden« die Rede ist, denn es ist ja nicht das Blech, das »emotionale Wucht« entfaltet, sondern es sind die Triebe, die wir darauf projizieren.
Um die Schwierigkeiten, die der Begriff der Externalisierung bereitet, etwas weiter ausholend zu erläutern: Wenn die Erde die von der Sonne empfangene Energie mitsamt der durch ihre Umwandlung anfallenden Entropie nicht externalisierte, d. h. in Form von Strahlung größerer Wellenlänge wieder loswürde, gäbe es auf ihr kein Leben. Der Anteil der Energie, der dauerhaft deponiert wird (siehe oben), ist verschwindend gering. Wenn es in der Pflanzenwelt nur Wachstum gäbe, wäre, bei Abwesenheit sonstiger Quellen — was also schon eingetreten wäre, bevor die Menschheit sich entsprechend betätigte —, das CO₂ irgendwann weitgehend aus der Atmosphäre verschwunden, mit der Folge, dass die Erde unter einem Eispanzer erstickte, weil dadurch die Durchschnittstemperatur weit unter den Gefrierpunkt fiele — ein Prozess der durch die bei Abkühlung zunehmende Albedo der Erdoberfläche nichtlinear voranginge. Dass die Temperatur, bei der sich ein Gleichgewicht zwischen eingestrahlter und abgestrahlter — plus einem äußerst geringen Anteil deponierter — Energie einstellt, von der stofflichen Zusammensetzung der Atmosphäre abhängt, stellt den Mechanismus dar, der, in umgekehrter Richtung, auch bei der Klimaerwärmung wirksam ist. Solange die Erwärmung vorangeht, ist allerdings noch kein Gleichgewicht erreicht, d. h. eingestrahlte Energie wird auch, abgesehen von der Deponierung, unvollständig abgestrahlt, weil sie teilweise auch in die Erwärmung der Erdrinde, der Meere und der Atmosphäre fließt.
Systemischer Mechanismus
Auch tierische Organismen müssen jenseits ihrer Wachstumsphase die Energie, die sie aufnehmen, vollständig wieder loswerden, und mit ihr auch diverse Stoffwechselprodukte, sonst würden sie an Fieber, Übergewicht oder Vergiftung zugrunde gehen — oder einfach platzen. Die Externalisierungsstrategie kann im Kontext einer weiteren Strategie des organischen Lebens, nämlich der der Vergesellschaftung, zu Problemen führen. Was geschieht, wenn Organismen auf begrenztem Raum sehr gute Bedingungen vorfinden und sich entsprechend vermehren, kann man sich beispielhaft an den Hefen im Most klarmachen: Sie gewinnen bei Sauerstoffmangel Energie aus Zucker durch Gärung. Dadurch entsteht ein recht haltbares, mehr oder weniger genießbares und unter Umständen erheiterndes Getränk, in dem genau der Stoff, dessen Konzentration im Bereich von 12-15% für die Haltbarkeit sorgt, in dieser auch seinen Produzenten den Garaus macht, sofern sie nicht schon vorher allen Zucker aufgebraucht haben. Externalisierung kann unter Umständen zum Exitus führen.
Dieser systemische Mechanismus, den die Menschheit spätestens seit ihrem Sesshaft-Werden zu ihrem Nutzen bzw. um ihrer Neigung zum Taumel zu frönen — Josef Reichholf vertritt sogar die These, dass letzteres der wahre Grund der Sesshaftigkeit gewesen wäre [Reichholf 2010] — einsetzte, macht ihr heute schwer zu schaffen; wobei das Stoffwechselprodukt eben nicht Alkohol, sondern, nicht allein, doch in einem gewaltigen Maße, CO₂ ist, das hier aber auch bei der Deckung des Energiebedarfs entsteht. Der erste Schritt zur Lösung solcher, durch Externalisierung entstandener, Probleme liegt darin, die Systemgrenzen auszudehnen und die Externalisierungsstrategie in größerem Maßstab zu verfolgen — was Menschen immer wieder machten, z. B. indem städtischen Gesellschaften dazu übergingen, ihre Stoffwechselprodukte nicht vor der Tür, sondern durch geeignete Maßnahmen und Vorrichtungen etwas weiter draußen zu entsorgen.
Doch auch diese angepasste Strategie kommt in Schwierigkeiten, sobald der Vergesellschaftungsprozess größere Räume über einzelne urbane Agglomerationen hinaus erfasst. Ihre Machbarkeit verschwindet mit den Systemgrenzen: wenn das Außen mit der fortschreitenden Aneignung der Natur in immer größere Distanz rückt bzw. für die Externalisierung unzugänglich wird, ist der Übergang zu anderen Verfahrensweisen ebenso angezeigt, wie wenn mit den externalisierten Stoffwechselprodukten zu große Mengen wertvoller Ressourcen verloren gehen: die Lösung heißt dann Internalisierung durch Deponierung, Reinigung bzw. Verwertung. Giftige Stoffwechselprodukte müssen sicher verwahrt oder unschädlich gemacht und wertvolle Inhaltsstoffe zurückgewonnen werden — wobei auch letztere Verfahren wiederum Abfall produzieren. Dieser sekundäre Abfall sollte möglichst leichter zu externalisieren oder zu deponieren sein als der primäre. Die Kläranlage oder die Schrottverwertung sind Anwendungen dieser Strategien. Dass letztere in einem beachtlichen Maß in den Ländern des globalen Südens stattfindet, wäre eher akzeptabel, sofern es mit vertretbaren Verfahren und unter menschlichen Arbeitsbedingungen stattfände.
Unbegründete »grüne« Energiehoffnungen
Allerdings ist Internalisierung nicht umsonst zu haben: sie kostet Arbeit, also, physikalisch gesprochen, Energie, und die wiederum ist ohne noch mehr stofflichen und energetischen Abfall nicht zu beschaffen. Die heute, vor allem durch die Publikationen von Jeremy Rifkin und Paul Mason, gerade auch im links-grünen Milieu weit verbreitete Vorstellung, dass es so etwas wie grenzenlos verfügbare »grüne« Energie zum Nulltarif geben könnte, ist völlig unbegründet [Fischbach 2017]. Auch im Aufmacher wird unterstellt, dass die Alternativen für eine »Energiewende […] bereits auf dem Tisch [liegen]« [Aljets, Müller 2019]. Das ist, wenn man die Zielsetzung einer vollständigen Elimination der CO₂-Emissionen ernst nimmt, leider nicht der Fall. Ein auf mineralische Träger vollständig verzichtendes Energiesystem, das die von der modernen Zivilisation geforderte Leistung zuverlässig dauerhaft bereitstellt, wird horrende, nur schwer kalkulierbare Kosten haben, weil es einen bisher kaum abschätzbaren Aufwand für die Pufferung der Energie involvieren, einen signifikanten Teil der gewonnenen Energie für seine eigene Reproduktion benötigen und weiterhin auf mineralische Ressourcen, insbesondere Metalle, inklusive all der Energie und des Abfalls, die deren Abbau, Aufbereitung oder auch Recycling verursacht, angewiesen bleiben wird. Die heutigen Formen und das heutige Ausmaß der Energienutzung—längst nicht nur in den Industrieländern, sondern auch in vielen Schwellenländern, insbesondere in deren Metropolen—sind aus erneuerbaren Quellen nicht zu realisieren und auch auf dieser Basis so wenig zu verallgemeinern wie auf der von mineralischen.
Nur begrenzt anwendbar, nämlich im Sinne einer verzögerten Externalisierung durch Umleitung in weitere Nutzungsformen wie z. B. bei der Kraft-Wärme-Kopplung, ist die Internalisierungsstrategie auf Energie selbst und die mit der Nutzung von Energie verbundene Entropie. Entropie lässt sich nur lokal reduzieren, indem man sie global erhöht. Man kann Wärme gegen ihre spontane Stromrichtung, also von tieferen zu höheren Temperaturen, nur transportieren, indem man an anderer Stelle noch mehr Wärme von höheren zu tieferen Temperaturen fließen lässt. Ein Kühlaggregat bzw. eine Wärmepumpe ist eine Wärmekraftmaschine, deren Zyklus rückwärts läuft, wobei die Nutzanwendung von Kühlaggregat und Wärmepumpe auf den gegenüberliegenden Phasen liegt: während die Wärmekraftmaschine Wärme bei hoher Temperatur aufnimmt, um die damit verbundene Energie in Form von mechanischer Arbeit und, da eine Umwandlung in solche zu hundert Prozent naturgesetzlich ausgeschlossen ist, Wärme tieferer Temperatur abzugeben, nehmen Kühlaggregat und Wärmepumpe Energie in Form mechanische Arbeit und Wärme tieferer Temperatur auf, um Wärme höherer Temperatur abzugeben. Die Gewinnung der mechanischen Arbeit erzeugt jedoch mehr Entropie als durch die Kühlung vernichtet wird, weshalb deren globale Bilanz positiv ist.
Fetischformel »Mobilität«
Als letzter Ausweg aus all den Verwicklungen des Abfalls und all den begrenzten Möglichkeiten, solchen zu externalisieren oder auch zu internalisieren, bietet sich die Vermeidung von Aktivitäten an, die solchen hervorbringen. Auch das ist, sofern man dem Leben kein absolutes Ende setzen möchte, nur in begrenztem Umfang möglich. Dazu sind vor allem strukturelle und organisatorische Lösungen gefordert — Wegeverkürzung, gemeinschaftliche Nutzung von langlebigen und reparierbaren Geräten und Anlagen, öffentlicher Verkehr, soziale Dienste — die nicht kurzfristig zu realisieren sind und vor allem auch massive Investitionen erfordern. Alles kein Fall von »Postwachstum«. Umfassende Lösungen liegen auch hierzu keinesfalls bereits auf dem Tisch. Dort liegt immerhin, neben Vorschlägen von anderen Autoren, auch der, den ich zusammen mit Stefan Kissinger für ein Teilproblem aus dem Zusammenhang des Verkehrs ausgearbeitet habe [Kissinger, Fischbach 2019]. Wovor wir in diesem Zusammenhang explizit warnen, ist das blinde Vertrauen in all die »smarten« Techniken und die unkritische Verwendung der Fetischformel »Mobilität« [Kissinger, Fischbach 2018]. Auch der Aufmacher setzt ja darauf, dass die außer »nachhaltig« und »post-fossil« auch irgendwie »intelligent vernetzt« zu sein habe. Doch gerade die »smarten« Techniken haben nicht nur ihre eigenen Ressourcen- und Abfallprobleme, sondern weisen neben ausgeprägten Rebound-Effekten auch ihre dunklen politischen Seiten, vor allem in Form erweiterter Überwachungsmöglichkeiten, auf. Dass so schicke Dinge wie Free Floating Car Sharing, Ride Sharing und die vielleicht irgendwann kommenden Robotaxis den automobilen Verkehr steigern und den öffentlichen aushöhlen, zeigen nicht nur systematische Überlegen, sondern bestätigen auch die verfügbaren Daten. Sie stellen nichts dar, worauf man in der Selbstverständlichkeit verweisen könnte, die viele Beiträge dazu für gegeben zu halten scheinen. Ein humanes öffentliches Verkehrssystem zeichnet sich unserer Meinung nach dadurch aus, dass man es ohne Smartphone benutzen kann.
Es gibt keine »fehlerfreien Maschinen«
Wenn in einem der weiteren Beiträge, der durchaus einige kritische Überlegungen enthält, im Zusammenhang mit dem sogenannten »autonomen Fahren« ganz im Ernst auf »fehlerfreie Maschinen« verwiesen wird [Beuth 2019], dann wäre ich glücklich, wenn mir das nur ein müdes Lächeln entlocken könnte. Leider mischt sich eine gewisse Bitterkeit in dieses Lächeln: gerade schält sich immer mehr heraus, dass eine fehlerhafte Software, die Schwächen einer fragwürdigen Konstruktion kompensieren sollte, die Ursache zweier Flugzeugabstürze mit hunderten von Todesopfern war. Für alle, die eine gewisse theoretische Kenntnis des Gebiets mit einiger Erfahrung verbinden können, ist dies die traurige Bestätigung einer mühsam erworbenen Einsicht. Daraus, dass Computer, wie immer wieder versichert wird, weder betrunken noch bekifft sein könnten, noch sich durch Aufmerksamkeit erheischende Erscheinungen am Straßenrand oder das Smartphone ablenken ließen, folgt keinesfalls, dass sie fehlerfrei wären. Sie machen zwar keine menschlichen aber manchmal halt maschinelle Fehler — und die dann sehr konsequent. Jener Beitrag ist leider kein Einzelfall: was, so frage ich mich, veranlasst zahlreiche Autoren aus einer sich als kritische verstehenden Linken dazu, so kritiklos die Propaganda nachzubeten, mit der eine Industrie Akzeptanz für eine bis heute unbewiesene Technik zu schaffen versucht? Für eine Technik zudem, die, nähme man das Ziel eines grundlegenden Umbaus des Verkehrssystems nach Kriterien der Verträglichkeit mit einem humanen Leben ernst, d. h. wenn man davon ausginge, dass die Zahl der Automobile um zwei Größenordnungen schrumpfen müsste, ohnehin zu dem würde, was man auf Englisch so schön ›a solution in search of a problem‹ nennt, sofern sie denn eine wäre.
In der Tat bildet, wie der Aufmacher feststellt, die Automobilindustrie einen wichtigen Sektor des deutschen Exportkapitalismus. Allerdings ist die Exportquote im Maschinen- und Anlagenbau noch höher und vor allem baut der Exportkapitalismus, den man durchaus auch »nationalegoistisch« nennen kann, dessen ungeachtet eben nicht auf die »Abschottungsgrenzen«, die mit ihm in einem Atemzug genannte werden. Etwas durchlässig müssen die Grenzen schon sein. Dabei geht es nicht allein um offene Grenzen für Waren, sondern ein beständiger Zustrom von Arbeitskraft trägt wesentlich dazu bei, deren Kosten auf einem Niveau zu halten, das es erlaubt, die ausländische Konkurrenz dauerhaft zu unterbieten — was den entscheidenden Faktor der deutschen Exportüberschüsse darstellt. Deshalb ist es keinesfalls nur leeres Gehabe, wenn sich die führenden Vertreter des deutschen Exportkapitalismus dezidiert weltoffen geben. Hinter dieser Weltoffenheit verbirgt sich ein in der Tat zu problematisierendes Externalisierungsverhalten: man externalisiert die Kosten, die mit dem Aufziehen von Kindern und der Ausbildung von Fachkräften verbunden sind. Nicht nur im prekarisierten Dienstleistungssektor, auch im gehobenen Bereich des Gesundheitswesens hat dies ebenso System wie in der IT, und soll, durchaus begrüßt in weiten Teilen des grün-linken Spektrums, noch ausgebaut werden. Nicht minder problematisch ist, um auf das Thema Verkehr zurückzukommen, ob seiner externen Effekte auch der Kosmopolitismus all der jugendlichen Hipster, die dem Verhalten der etwas älteren und betuchteren Elitenvertreter mit Hilfe von Ryanair, Airbnb und Uber nacheifern. Die Kosten trägt die zunehmend bedrängte Bevölkerung in den Metropolen und Tourismusmagneten.
Externalisierung von Kosten kann also auch mit einwärts gerichteten Strömen verbunden sein. Externe Kosten zu beziffern ist grundsätzlich mit Schwierigkeiten behaftet, insbesondere wenn es die Naturvoraussetzungen wirtschaftlicher Aktivitäten oder auch die menschliche Gesundheit betrifft. Die Kalkulationen, die dem menschlichen Leben einen in Geld ausdrückbaren Wert zuzuweisen versuchen, machen diesen davon abhängig, wie weit die Herstellungskosten der Arbeitskraft abgeschrieben und wieviel vom Lebensarbeitspensum noch aussteht. Neugeborene und Rentner sind also fast nichts wert, während Absolventen einschlägiger Studiengänge gerade im Zenit ihrer Wertkurve stehen. Zurecht mag man das als zynisch empfinden, doch überhaupt keinen Anhaltpunkt gibt es für den Wert einer ausgestorbenen wilden Spezies, vielleicht sogar einer, von der die Menschheit noch nichts erfahren hat, weil ihr Aussterben ihrer Katalogisierung zuvorkam. Zudem ist auch unklar, an wen finanzielle Kompensationen, so ihre Höhe denn zu ermitteln wäre, zu leisten wären: die Natur hat weder ein Bankkonto noch für Geld eine Verwendung.
Umbau des soziotechnischen Systems
Der Wert von Naturressourcen ist soweit kalkulierbar, wie ihre Beschaffung und Wiederherstellung durch, zu entlohnende, menschliche Arbeit zu erfassen ist. Das geht für manche Stoffe, wie z. B. die Metalle, wenn für sie in einer spezifischen Verarbeitungsform ein Recyclingprozess bekannt ist, wenigstens zu großen Teilen, sofern man von der Frage absieht, welcher Wert den durch Bergbau zerstörten Landschaften beizumessen wäre, doch für andere überwiegend nicht. Für so etwas Banales wie eine Karre Sand gibt es weder einen Recyclingprozess noch ist bekannt, wie die der Sandgrube bzw. dem Baggersee zum Opfer gefallene Natur zu bewerten oder gar wiederherzustellen und ob das überhaupt sinnvoll wäre. Die Internalisierung von Kosten stellt eine große und voraussichtlich nie abzuschließende Aufgabe dar. Ihr Abschluss wäre auch nicht wünschenswert: dies würde bedeuten, dass die Natur vollständig in der Geldwirtschaft aufgegangen wäre. Das Ziel umfassender Nachhaltigkeit des Wirtschaftens — ein Merkmal, das meist mit dem Schutz der Natur assoziiert wird, doch tatsächlich ihre vollständige Inwertsetzung implizierte — würde totale Naturbeherrschung voraussetzen und trotzdem scheitern, weil die entscheidenden Prozesse in der Natur, deren Teil die Menschheit bleibt, irreversibel sind.
An die Stelle der großspurigen Scheingewissheit über »nachhaltige Mobilität« und was sonst noch an »Nachhaltigem« propagiert wird, wäre der bedachte Umbau des soziotechnischen Systems zu setzen, der zwar einerseits versucht, wichtige Aspekte — Stoff- und Energieströme, die involvierten Räume, Landschaften, Organismen und Artefakte — möglichst umfassend zu würdigen, doch andererseits auch ein klares Bewusstsein davon behält, dass uns die Totalität der Bedingungen des Lebens unzugänglich bleibt. Das schließt sicher ein, vieles zu internalisieren, noch besser jedoch zu vermeiden, was bisher externalisiert wurde, doch die Formen in denen dies geschehen sollte, sind genaueren Nachdenkens wert. Es gibt dafür keine Pauschallösungen.
Sicher kann man sich »eine neue soziale Bewegung gegen die Autogesellschaft« [Aljets, Müller 2019] wünschen, doch das wäre auch eine Bewegung dieser Gesellschaft gegen sich selbst, denn so klar lassen die Grenzen sich nicht ziehen, auch wenn es identifizierbare Kräfte gibt, die den Status quo möglichst prolongieren wollen. Auch hier scheint Externalisierung im psychoanalytischen Sinne wirksam zu sein. Worum es geht, ist doch die Selbstveränderung einer Gesellschaft, die Befreiung aus einer Verstrickung, die mit der Gesamtheit auch alle Individuen umfasst, längst nicht nur diejenigen, die diese Befreiung zu verhindern versuchen, weil der gegenwärtige Zustand für sie so unerhört profitabel ist.
Soziale Bewegung« ist ein Terminus, der im linken Diskurs weitgehend positiv konnotiert ist. Dabei wäre eine kritische Aufarbeitung der Erfolge und Misserfolge ihrer historischen Ausprägungen angezeigt. Das betrifft nicht nur die Post-68er-Bewegungen, deren emanzipatorischer Impuls nicht viel weiter trug, als er der Flexibilisierung aller Beziehungen, d. h. der neuen Unverbindlichkeit des neoliberalen Vergesellschaftungsmodells, entsprach, als auch die Friedensbewegung, die nicht mehr erzielte als einen flüchtigen Scheinerfolg, und die Umweltbewegung, die, mit Ausnahme des FCKW-Problems, bei dem auch auf staatlicher Ebene die Entschlossenheit groß genug war, zwar immer wieder Teilerfolge erzielte — das Verbot einzelner hochriskanter Agrarchemikalien wie DDT, während das von Glyphosat immer noch aussteht, das voraussichtliche Ende der Atomenergie eben nur in Deutschland — und ansonsten Umweltschutz vor allem in Form vieler teurer End-of-Pipe-Lösungen — Katalysator, Rauchgasentschwefelung, Kläranlagen etc. — durchsetzte, doch bisher nirgendwo zur globalen Beseitigung der Schadensursachen vordrang. Es ist mehr gefordert als eine soziale Bewegung nach historischem Muster. Solange nicht nur die klare Wahrnehmung der Probleme des Naturverhältnisses der menschlichen Gattung, unter denen der Automobilismus nur eines ist, sondern auch plausible, materiell ausgearbeitete, Strategien zu ihrer Bewältigung keine hegemoniale Position erreichen und die Gestalt institutioneller Macht annehmen, treiben wir auf eine düstere Zukunft zu.
Rainer Fischbach ist Softwarexperte in der Industrie und Publizist. Er hat vor allem zum Zusammenhang von Technik, Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft veröffentlicht. Von ihm sind unter anderem erschienen »Mensch-Natur-Stoffwechsel: Versuche zur politischen Technologie« (2016) und »Die schöne Utopie: Paul Mason, der Postkapitalismus und der Traum vom grenzenlosen Überfluss« (2017), beide bei PapyRossa. Weitere Informationen unter rainer-fischbach.info
Literatur
Aljets, Janna; Müller, Tadzio 2019: Bewegt Euch. Anders. OXI, März, 1.
Beuth, Frank 2019: Fracht oder Freiheit. OXI, März, 14-15.
Brand, Ulrich; Wissen, Markus 2017: Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. München: oekom.
Fischbach, Rainer 2016: Mensch — Natur — Stoffwechsel: Versuche zur Politischen Technologie. Köln: PapyRossa.
Fischbach, Rainer 2017: Die schöne Utopie: Paul Mason, der Postkapitalismus und der Traum vom grenzenlosen Überfluss. Köln: PapyRossa.
Fischbach, Rainer; Kissinger, Stefan 2018: Elektromobil und intelligent vernetzt ins Chaos. Makroskop, 4. Dezember https://makroskop.eu/2018/12/elektromobil-und-intelligent-vernetzt-ins-chaos/.
Fischbach, Rainer; Kissinger, Stefan 2019: Für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Makroskop, 8. Februar https://makroskop.eu/2019/02/fuer-die-zukunftsfaehigkeit-deutschlands/.
Flassbeck, Heiner 2019: Ein großer Schritt für Deutschland, ein kleiner für die Menschheit. Makroskop, 20. Februar 2019 https://makroskop.eu/2019/02/ein-grosser-schritt-fuer-deutschland-ein-kleiner-fuer-die-menschheit/.
Land, Rainer 2017: Der Irrtum der Postwachstumsdebatte. Makroskop, 4., 25., 28. April http://www.rla-texte.de/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-28-der-irrtum-der-postwachstumsdebatte-1-2-3.pdf.
Lessenich, Stephan 2018: Neben uns die Sintflut: Wie wir auf Kosten anderer leben. Aktual. u. überarb. Taschenbuchausgabe, Müchen: Piper.
Müller, Albrecht 2017: Stephan Lessenichs »Externalisierungsgesellschaft« – ein wortgewaltiger Analyseversuch ohne praktische Konsequenz. Nachdenkseiten, 18. August https://www.nachdenkseiten.de/?p=39668.
Reichholf, Josef H. 2008: Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends. Frankfurt am Main: Fischer (Fischer TB 17439)
Reichholf, Josef H. 2010: Warum die Menschen sesshaft wurden: Das größte Rätsel unserer Geschichte. Frankfurt am Main: Fischer (Fischer TB 17932)
Sablowski, Thomas 2018: Warum die imperiale Lebensweise die Klassenfrage ausblenden muss. Luxemburg Online, Mai https://www.zeitschrift-luxemburg.de/warum-die-imperiale-lebensweise-die-klassenfrage-ausblenden-muss/.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode