Zerschlagen, verstaatlichen, kontrollieren? Wie die Macht der Big-Tech-Konzerne begrenzt werden soll
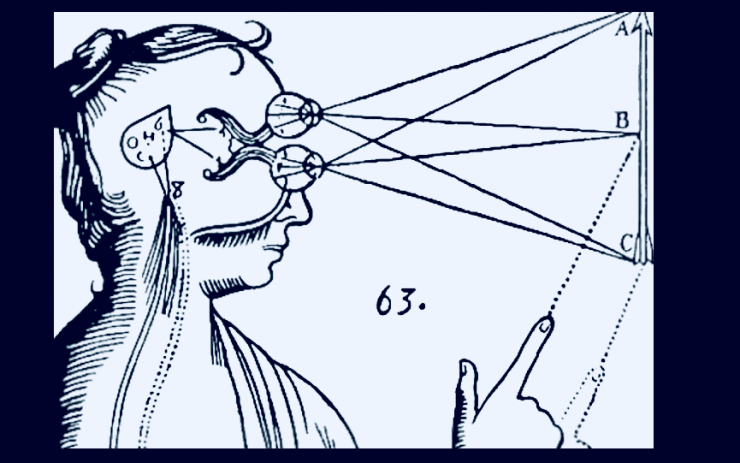 Gemeinfrei
GemeinfreiSollen Facebook, Amazon und Google zerschlagen werden? Angesichts der wachsenden Marktmacht der Konzerne wird das längst nicht mehr ausgeschlossen. Doch auch Kritiker der großen »BAADD« stimmen nicht alle in den Chor ein. Sind mehr öffentliche Kontrolle oder Verstaatlichung die Alternativen?
»Nie zuvor waren die Tech-Riesen Facebook, Amazon und Google so mächtig wie heute«, hieß es vor ein paar Tagen in der »Welt« – die noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machte: Es sei nämlich ebenso Fakt, dass beherrschende Konzerne, zu denen mitunter auch Apple und Netflix gezählt werden, noch nie »so sehr unter Druck wie jetzt« standen. Kritiker hätten ihre Zerschlagung ins Spiel gebracht.
Man liest jetzt öfter davon – und bisweilen drängt sich der Verdacht auf, die selbstkritischen Auftritte etwa von Mark Zuckerberg oder die öffentliche Geißelung des eigenen Angebots als krankmachend und vereinsamend könnten schon eine Art vorauseilende Abwehr möglicher politischer Regulierungen sein.
Die KollegInnen von netzpolitik.org haben jetzt ein paar der Stimmen zusammengetragen, die angesichts wachsender Marktmacht für eine Zerschlagung großer Techkonzerne plädieren. Das Thema bekommt deshalb auch einige Aufmerksamkeit, weil seit einiger Zeit »auch in wirtschaftsliberalen Kreisen Sorge über den Daten- und Plattformkapitalismus à la Google und Facebook geäußert« wird.
Dabei geht es um die Befürchtung, Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple könnten aufgrund ihrer schieren Größe, der Dominanz in Teilmärkten und von Umsatzanteilen »zunehmend außerhalb der Regeln des Wettbewerbs spielen«. Es werde sogar in der »Financial Times«, von netzpolitik.org als »Hausblatt der Londoner Bankerszene« bezeichnet, »schon laut über Alternativen zum kaum regulierten Oligopol der großen Plattformen nachgedacht«.
Aufspaltung für besseren kapitalistischen Wettbewerb?
Die Frage wäre hier: Worin besteht eigentlich die Alternative, was ist ihre Dimension, wenn durch Aufspaltung eines der großen »BAADD«-Unternehmen – die Abkürzung hat der »Economist« ins Spiel gebracht, sie steht für big, anti-competitive, addictive and destructive to democracy – zwar ein Oligopol gebrochen, aber dann die ach so tolle Konkurrenz, das Rennen um Renditen, Marktanteile, Einfluss und unsere Daten bloß auf einem umgepflügten Spielfeld mit etwas mehr Playern stattfindet? »Wenn wir die Vorzüge von echtem Wettbewerb wollen, wird es wohl ohne Aufspaltungen der Unternehmen nicht gehen«, wird etwa der US-Rechtsanwalt Gary Reback zitiert. Wollen das auch zum Beispiel die Beschäftigten?
Ein weiteres Argument für Aufspaltung aus kartellpolitischen Gründen: die wachsende politische Macht. In der »Welt« heißt es, Experten und Politiker würden sich immer öfter »fragen, ob der Einfluss dieser Unternehmen auf gesellschaftliche Entscheidungsprozesse mit demokratischen Spielregeln noch vereinbar sei«. Vor allem in den USA ist die Debatte zusätzlich geprägt von Vorwürfen, ausländische Regierungen würden über Soziale Netzwerke Einfluss auf Entscheidungsprozesse, etwa auf Wahlen, nehmen.
Unabhängig von dieser politischen Note lässt sich also ein Raum der marktwirtschaftlich begründeten Einhegung der großen »BAADD« beschreiben. In dem wird klassisch kartellrechtlich argumentiert, es geht unter anderem darum, ob für Verbraucher ungünstige Monopole entstehen (was mit dem unausgesprochenen Gedanken verknüpft ist, eine möglichst »freie Konkurrenz« der Vielen würde bessere Ergebnisse erzielen, was aber erst einmal nur eine Behauptung ist: Bloß durch mehr Wettbewerb wird es kaum mehr Datenschutz, bessere Arbeitsbedingungen für die vielen Beschäftigten oder weniger Profitlogik geben. Im Gegenteil.
Rechtlich ist eine Zerschlagung durchaus möglich
Immerhin ist diese Stoßrichtung der marktwirtschaftlich begründeten Einhegung nicht präzedenzlos: Die »Welt« erinnert daran, dass Standard Oil in den USA vor mehr als 100 Jahren zerschlagen wurde, als das Unternehmen einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent erreichte. Oder an den Fall des Telekom-Riesen AT&T, der auch wegen eines dominant gewordenen Monopols aufgespalten wurde.
Google kontrolliert derzeit rund 90 Prozent des Suchmaschinenmarkts; Facebook ist mit einem Anteil von etwa 75 Prozent in den USA der beherrschende soziale Kommunikationsdienst; Amazon trumpft mindestens im E-Book-Markt überragend auf. Auf Facebook und Google sind zuletzt in den USA etwa zwei Drittel des Marktes für Onlinewerbung entfallen. Google und Apple bestücken praktisch alle Smartphones mit ihren Betriebssystemen und kontrollieren darüber praktisch auch den App-Markt mit. Und abseits von Nischen gibt es auch keinen normalen Computer, der nicht Software von Microsoft und Apple zum Laufen braucht.
Es gibt in der Debatte um die Einhegung der »BAADD« noch einen zweiten Raum, in dem es eher um die Ideologie des Internets und die Chancen von öffentlicher Kontrolle geht. Hierfür steht beispielhaft der Schriftsteller Franklin Foer, der mit den Worten zitiert wird: »Die Ideale der Technologie-Konzerne sind wunderbar, aber sie können von mächtigen Instanzen gekapert werden. Wenn das passiert, werden sie selbst zum Gegenteil dessen, was sie versprochen haben.« Genau das ist seiner Meinung nach längst geschehen: Die Welt ist nicht einem globalen Bewusstsein näher gekommen, sondern unter die Fuchtel eines das Leben immer stärker dominierenden Monopols der Wenigen.
Am Rande der DLD-Konferenz im Januar sagte der Ökonom Scott Galloway dagegen der »FAZ«, wegen der erreichten Größe und dem Einfluss der »BAADD« verhinderten diese den Wettbewerb – deshalb solle man »diese großen Tech-Konzerne aufbrechen«. Galloway wiederum lehnt eine stärkere Regulierung ab. Warum das keine Option für ihn ist: »Das würde mehr staatliche Stellen bedeuten, die nachher nicht mehr abgeschafft werden und ich bin kein Freund einer immer weiter aufgeblähten Verwaltung.«
»Wir sollten sie nun aufbrechen, weil wir Kapitalisten sind«
Nicht eben überraschend, dass Anhänger des Marktparadigmas gegen die stärkere Kontrolle, Regulierung und Aufsicht von Konzernen dies in Stellung bringen. Es hat auch etwas mit den ökonomischen Grundüberzeugungen zu tun. Galloway bringt es auf seinen Punkt: »Wir sollten sie nun aufbrechen, weil wir Kapitalisten sind.« Weil.
Andere Kritiker von Internetriesen setzen dagegen sehr wohl auf kürzere staatliche Zügel oder eine deutlichere öffentliche Einmischung. »Ich halte eine stärkere öffentliche Regulierung und Kontrolle der Unternehmen durch nationale und europäische Aufsichtsbehörden jedenfalls im Moment für wesentlich sinnvoller als deren Zerschlagung oder Aufteilung«, sagte unlängst Ulrich Dolata, der Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart, in der »Frankfurter Rundschau«. Für ihn sind zumindest Facebook und Google »im ökonomischen Sinn keine Monopole. Ihre Umsätze und Gewinne finanzieren sie vornehmlich durch Werbung. In diesem Bereich sind sie zwar wichtige Akteure, aber nicht marktbeherrschend.«
Der Ruf nach einer neuen Aufsichts- und Regulierungsbehörde
Dolata geht es aber nicht zuerst um reines Kartellrecht oder die Wiederverbesserung von kapitalistischen »Wettbewerbsfreiheiten«, sondern um Maßnahmen gegen einen eher politischen Gehalt von Macht durch Marktbeherrschung. Er nennt das Beispiel »Facebook-Gesetz«, mit dem seiner Auffassung nach ein Konzern »nun gewissermaßen offiziell die Funktion eines Moderators der öffentlichen Meinungsbildung und gleichzeitig die des Richters« erhalten habe. Seine Forderung: »eine neue Aufsichts- und Regulierungsbehörde, die das Internet im allgemeinen Interesse kontrolliert. Dort säßen dann anerkannte und öffentlich bestellte Experten, die wissen, wie und was Facebook, Google und Co. mit ihren Algorithmen steuern und beeinflussen können.«
Martin Sandbu von der »Financial Times« schlägt als Alternative zur Aufspaltung vor: ein öffentliches Angebot der Dienstleistungen, die die großen »BAADD« sonst offerieren. Sein Argument: Viele Vermittlungsplattformen hätten »den Charakter einer grundlegenden öffentlichen Dienstleistung«. Regierungen sollten, wo es neue digitale Marktplätze entstehen, »selbst die Verantwortung für diesen Marktplatz zu übernehmen«. Mit einer eigenen APP oder über zumindest die Kontrolle des Zugangs zu privaten Angebote.
Nick Srnicek vom King’s College in London geht noch einen Schritt weiter und das führt sozusagen in den dritten Raum der Debatte: Er bringt eine Verstaatlichung ins Spiel. Da digitale Plattformen »eine natürliche Tendenz zum Monopol« hätten, unter anderem wegen der Netzwerkeffekte, und zugleich kaum eine Bewegung absehbar wäre, der es gelingen könnte, »kooperative Plattformen zu schaffen, humanere, nettere Version der großen Plattformen«, ist für Srnicek, wie er nun Zeit online verriet, »die Überführung dieser Firmen in einen irgendwie gearteten öffentlichen Besitz die Ideallösung«.
Google oder Amazon dem Staat unterstellen?
Einerseits. Andererseits tauchen da auch einige Schwierigkeiten auf. »Google oder Amazon dem Staat unterstellen, wie soll das technisch, ökonomisch und rechtlich funktionieren?«, fragt Srnicek, fordert aber, sehr ernsthaft darüber nachzudenken und neue Modelle zu entwickeln, »wie eine öffentliche, gemeinnützige Kontrolle aussehen könnte. Das Thema drängt, aber die Diskussion hat noch gar nicht richtig begonnen.«
Zwischen den beschriebenen Räumen der Debatte über eine Einhegung der großen »BAADD« verlaufen einige Gräben – auch einer der Zeitdimension, weil es einen gravierenden Unterschied macht, ob ich jetzt kartellrechtlich ein paar Grenzen ziehe oder über die gesellschaftspolitisch weitreichende Frage nach einer echten öffentliche Kontrolle von Plattformen nachdenke; ein Graben reißt auch zwischen denen auf, die im Grunde nur »besseren Wettbewerb« wollen und jenen, die die aktuelle, technologisch getriebene Entwicklung des Kapitalismus für eine grundlegende Wende in den Produktionsverhältnissen halten, auf die man auch grundlegend antworten müsste.
Natürlich gibt es hier und da Überschneidungen, uns es wird wohl auch so sein, dass die Debatte über mehr Kontrolle über und eine bessere Einhegung der »BAADD« auch wieder ein Lehrstück in Bündnispolitik, Kompromissen und dem Kampf darum sein wird, unter eher ungünstigen Kräfteverhältnissen etwas zu erreichen, das selbst nicht den späteren Weg hin zu weitergehenden Alternativen verbaut.
Wasser in den postkapitalistischen Wein gegossen
Eine der Konfliktlinien lässt sich gut illustrieren, wenn man einen Kommentar aus der »Welt« und eine Rede des Technikkritikers Evgeny Morozov liest: in dem einen Fall wird sogar noch das Monopol aus marktwirtschaftlicher Überzeugung gutgeheißen, in dem anderen wird eine beträchtliche Menge Wasser in den postkapitalistischen Wein linker Kritiker gegossen, der in der Entwicklung hin zum Plattformkapitalismus immerhin noch das emanzipatorische Potenzial sieht, von hieraus wäre der Weg zur Vergesellschaftung des technisch Machbaren nicht mehr so weit.
Die »Welt« schreibt, »Monopole sind nur dann schlechter als perfekter Wettbewerb, wenn sie zu schlechteren Ergebnissen führen, sich der Monopolist also nicht um Kunden bemüht, sondern diese zu übervorteilten, wehrlosen Abhängigen degradiert. Sobald drohende Konkurrenz den Monopolisten jedoch zwingt, den Nutzen der Kunden durch steigende Qualität und attraktive Preise ständig zu mehren, ist dagegen nichts einzuwenden.«
Und ohne dass es eine Reaktion darauf wäre, meint Evgeny Morozov (die Rede ist dokumentiert in den »Blättern für deutsche und internationale Politik«, gleiches gilt für eine zum Thema ebenso passende Rede des Postkapitalismus-Protagonisten Paul Mason), »eine unangenehme und von den meisten Fürsprechern der digitalen Wirtschaft kaum jemals erwähnte Tatsache ist die, dass der Markt trotz der Fülle an Start-ups und der massiven Unterstützung, die sie von Risikokapitalgebern erhalten, unter fünf großen Konzernen – Apple, Google, Facebook, Microsoft und Amazon – aufgeteilt ist und viele Start-ups über genau ein Geschäftsmodell verfügen: nämlich von einem dieser Konzerne aufgekauft zu werden.« Das heißt, der Wettbewerb findet sogar statt, damit die Monopole immer monopolistischer werden. Morozov: »Die Start-ups müssen sich also nicht sonderlich intensiv mit ihrer Umsatzgenerierung und Rentabilität beschäftigen; es ist völlig ausreichend, wenn sie ihre Dienstleistungen so konzipieren, dass sie auf einer Linie mit den Expansionsstrategien von Akteuren wie Google oder Facebook liegen, die nach der Übernahme eines Start-ups und der von ihm gewonnenen Daten dann schon eine Möglichkeit finden werden, es in ihre riesigen Datenimperien zu integrieren.«
Morozovs Warnung zielt von hier ausgehend unter anderem auf die Überbewertung von »technoutopischen Narrative«. Er sagt aber auch, da sich der Kapitalismus mal wieder in einer schweren Krise befindet, solle man zwar »alternative Visionen davon, wie wir unser Leben organisieren, nicht einfach von vornherein verwerfen«.
Die Debatte um die Einhegung oder Aufspaltung der großen »BAADD« hat den Vorteil, dass es sich dabei nicht um die nächste Idee von Facebook, Google und Co selbst handelt. Und dass man aus der Frage, wie deren Macht und in wessen Interesse mit welchen Mitteln wirksam eingeschränkt werden kann, eine Menge über die Widersprüche lernen kann, die sich aus Übergangsforderungen und der Utopie von Alternativen ergeben.
Bereits genannter Paul Mason übrigens glaubt, dass die Debatte darüber, wie man nicht noch den letzten Rest des Lebens und der Produktion der Mittel zum Leben und des Lebens selbst »auf Marktprozesse« reduzieren lässt, hierzulande bessere Voraussetzungen findet als in den USA oder Großbritannien. Mason zielt hier wohl auf die Tradition neoliberaler Ideen ab. Zugleich liegt darin ja erst einmal auch nur ein Versprechen, das in der deutschen Debatte eingelöst werden müsste.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode










